In der Schule endet der Antisemitismus 1945
Ein antisemitischer Vorfall an der Schule? „Na, dann machen wir doch mit der Klasse einen Besuch in der Synagoge. Die werden das da schon richten.“ Das sei ein häufiger Reflex an Schulen, beobachtet Rebecca Seidler, Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde in Hannover und Antisemitismus-Beauftragte des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden von Niedersachsen. „Beim Thema Antisemitismus erlebe ich eine Menge Hilflosigkeit bei den Lehrkräften“, berichtet sie.
Seit der jüngsten Eskalation im Gazastreifen brennen auch in Deutschland israelische Flaggen, wird das Existenzrecht des jüdischen Staates negiert, Synagogen werden bedroht und jüdische Bürger eingeschüchtert. Die antisemitischen Ausschreitungen gehen von jungen Menschen mit Wurzeln in muslimisch geprägten Ländern aus. Gegen diesen Antisemitismus hätte man schon lange gegensteuern können, sagen Experten.

Rebecca Seidler hat diese Situation viele Male erlebt: Da stehen die Jugendlichen im jüdischen Gemeindezentrum in Stöcken. In vielen Gruppen fehlen auch Teilnehmer, denn viele Eltern verbieten ihren Kindern von vornherein den Besuch in einer Synagoge. Junge Besucher weigerten sich, im Gebetsraum eine Kopfbedeckung aufzusetzen. Die nächste Klippe: Für den jüdischen Glauben und Alltag in Deutschland, über den Seidler und ihr Team eigentlich mit den Schulklassen sprechen wollten, interessiert sich mancher kaum. Diese Jugendlichen kommen direkt zu dem Thema, das ihnen auf den Nägeln brennt: „Wie stehen Sie zu Israel?“
Juden und Muslime haben mehr gemeinsam, als sie oft denken.
Seidler ist selbst Pädagogin. Allen negativen Erfahrungen zum Trotz ist ihr die Arbeit mit Schulklassen ein Anliegen. Denn „Aha-Momente“ gibt es auch regelmäßig: „Juden und Muslime haben mehr gemeinsam, als sie oft denken.“ Wenn es um Diskriminierungserfahrungen von Zugewanderten geht, entdecken muslimische Jugendliche überraschende Parallelen zu ihren jüdischen Gesprächspartnern. Viel zu spät, meint der Islamwissenschaftler Dr. Michael Kiefer von der Universität Osnabrück. „Damit müsste man schon im Kindergarten anfangen. Und in schulischer Hinsicht wäre viel mehr möglich.“
Wissenschaftler fordert mehr Geld für Unterrichtsmaterial
Er fordert, dass sich nicht nur der Religionsunterricht, sondern auch Ethik, Politik und Sozialkunde mit antisemitischen Vorurteilen und einer differenzierten Sicht auf den Nahostkonflikt befassen müssen. „Es gibt wenig Unterrichtsmaterial dazu. Die Mittel müssen bereitgestellt werden, um Material zu entwickeln.“ Antisemitische Ausfälle junger deutscher Muslime habe man bereits 2002 im Zusammenhang mit der Al-Aqsa-Offensive erlebt, dann wieder 2014 und jetzt erneut. „In fast zwanzig Jahren hätte man schon viel tun können.“
Die jungen Leute, die jetzt auf die Straße gehen, haben das deutsche Schulsystem durchlaufen, ohne ihre Ansichten zu revidieren.
Welche Vorgaben gibt es im Schulunterricht? Sebastian Schumacher, Pressesprecher im Kultusministerium, erklärt: „Thematisch kann der Israel-Palästina-Konflikt in der Schule aus mindestens vier Perspektiven betrachtet werden.“ Das kann als politischer und religiöser Konflikt sein, als Konflikt in den Medien und unter dem Fokus Antisemitismus. Vorgesehen ist das frühestens in Klasse 7/8. Und das heikle Thema ist – außer in Klasse 9/10, wenn die Shoa auf dem Lehrplan steht – jeweils eine Option unter mehreren für die Lehrer. Rebecca Seidler merkt an: „Die jungen Leute, die jetzt auf die Straße gehen, haben schließlich auch das deutsche Schulsystem durchlaufen, ohne ihre Ansichten zu revidieren.“
In der Schule endet der Antisemitismus 1945
In deutschen Schulen, kritisiert Islamwissenschaftler Kiefer, dominiere eine „Holocaust Education“ – „als höre der Antisemitismus 1945 auf“. So setze sich in Familien aus dem Nahen Osten fort, was Kiefer „transgeneratives Unwissen“ nennt: Schon kleine Kinder rufen „Kindermörder Israel“, ohne zu verstehen, was sie da sagen. Ältere wissen zwar über die Vertreibung palästinensischer Familien bestens Bescheid, aber haben keine Ahnung, dass der Krieg von 1948 gar nicht von Israel begonnen wurde.
Reine Fakten ändern absurde Ansichten nicht.
Qualifizierter Schulunterricht könnte den Jugendlichen vermitteln, dass Angst und Misstrauen gegenüber Juden keineswegs in der Tradition des Islams wurzeln. Ägyptische Muslimbrüder waren es, die in den 1950er Jahren die antisemitische Propaganda aus Europa mit Islamismus zu einer explosiven Mischung verquickten. Doch Kiefer weiß auch: „Reine Fakten ändern absurde Ansichten nicht.“ Denn hier spielen Emotionen mit – einseitige Solidarität mit den mutmaßlichen Opfern, aber auch eine Verletzung der eigenen religiösen Gefühle.
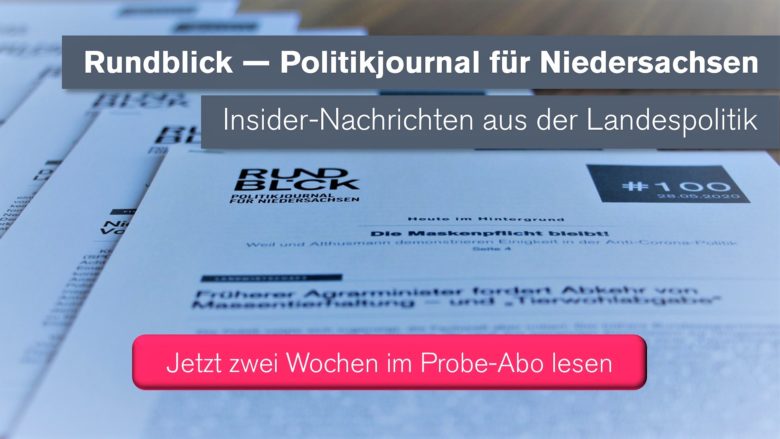
Recep Bilgen, Vorsitzender des islamischen Dachverbands Schura Niedersachsen, kennt die Diskussionen mit Gemeindemitgliedern: „Wenn im Gazastreifen Freitagsgebete angegriffen werden, wenn die Situation ausgerechnet an den letzten Tagen des Ramadans eskaliert, dann ist das ein religiöses Symbol.“ Bilgen hat am Dienstag gemeinsam mit jüdischen, palästinensischen und muslimischen Organisationen und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay den „Hannover-Appell“ für ein friedliches Miteinander unterzeichnet.
Viele gehen eher in die Shisha-Bar als in die Moschee.
„Man muss die Menschen zusammenbringen, es geht nichts über Sprechen“, meint er – und kündigt gemeinsame Veranstaltungen mit jüdischen Organisationen an. Sein Vorsatz: „Wir müssen Antisemitismus öfter thematisieren als in der Vergangenheit.“ Allerdings, meint Islamwissenschaftler Kiefer, erreichen die Moscheegemeinden nur einen kleinen Teil der jungen Leute: „Viele gehen eher in die Shisha-Bar als in die Moschee.“
In einem Punkt sind sich jüdische und muslimische Experten einig: Begegnung hilft. „Zum Glück haben wir Gemeindemitglieder, die so mutig sind, auch in die Schulen zu gehen“, sagt Rebecca Seidler. Aber ihr Engagement ist ehrenamtlich. Da sind Schulbesuche am Vormittag kaum leistbar. „Es müssen hauptamtliche Kräfte finanziert werden, die das leisten können“, fordert Seidler. Und zwar nicht in prekären Projektstellen, denn das ständige Anträge schreiben, Hoffen und Zittern, ob das Projekt verlängert wird, sei zermürbend.
Anruf bei einer jüdischen Gemeinde irgendwo in Niedersachsen. Die Person am Telefon möchte nicht zitiert werden. Man habe keine Kapazitäten frei, um Interviews zu geben. Wichtigste Aufgabe sei jetzt, für die eigene Gemeinde da zu sein – und dafür seien die Ressourcen knapp genug. Es könne nicht auch noch in der Verantwortung der Betroffenen liegen, die Prävention gegen die Übergriffe zu übernehmen. Denn schließlich: „Es ist nicht unser Antisemitismus.“
Von Anne Beelte-Altwig




