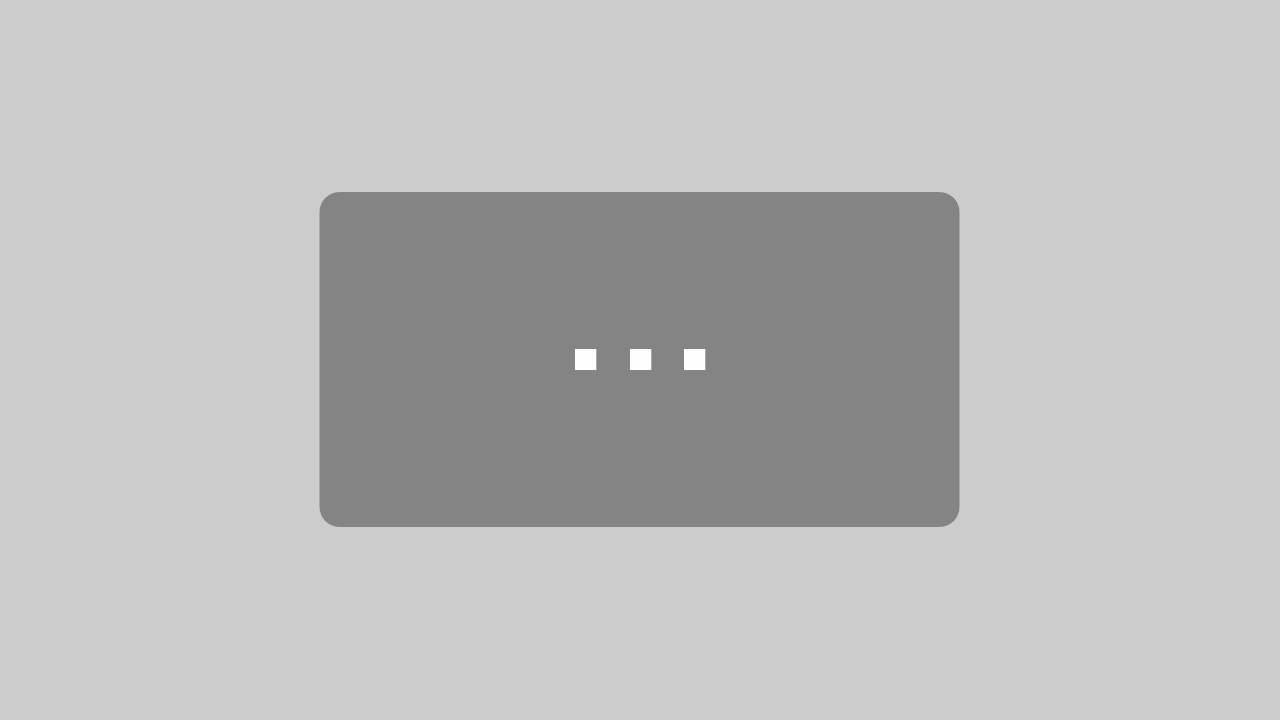Pro & Contra zum niedersächsischen Sonderweg
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) haben zu Wochenbeginn einen „niedersächsischen Weg“ zur Lockerung der bisherigen Verbote in der Corona-Krise verkündet. Dieses Verhalten fand bundesweit Widerhall in den Medien, wurde als „Vorpreschen“ oder „Aus der Reihe tanzen“ beschrieben. Das wirft die Frage auf, inwieweit wir wirklich ein einheitliches Konzept für alle 16 Bundesländer brauchen. Die Rundblick-Redaktion widmet sich der Frage in einem Pro und Contra.

Pro: Niedersachsen hat mit dem eigenen Plan dem Föderalismus einen Bärendienst erwiesen. Der „normale“ Alltag droht nun in unterschiedlichen Ländern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten wieder einzukehren. Das wird den Druck auf den politischen Kessel noch erhöhen, meint Martin Brüning.
Schon seit Tagen bewahrheitet sich die These vieler Beobachter, wonach der Shutdown für die Politik einfacher einheitlich zu gestalten war als die sukzessive Öffnung. Von einem Flickenteppich der Regelungen zu sprechen wäre vermutlich übertrieben, aber Unterschiede in den Ländern treten immer deutlicher hervor und ein Überbietungswettbewerb in Bezug auf wiedergewonnene Freiheiten stand unmittelbar vor der Tür. Die Reaktion von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und der Landesregierung, den Debatten um einzelne Punkte bei Corona-Öffnungen mit dem Niedersachsen-Plan einen Riegel vorzuschieben, war mehr als verständlich. Angesichts mancher Entscheidungen in anderen Ländern tauchte in den vergangenen Wochen berechtigterweise immer wieder die Frage auf, ob die niedersächsische Landesregierung eigentlich auch eigene Pläne verfolge, oder sich je nach Lage der einen oder anderen Meinung anderer Landesregierungen anschließe. Hinterherlaufen statt vorangehen, diesen Eindruck konnte man dadurch bekommen, und das war ein unerfreulicher Zustand für die niedersächsische Landespolitik. Mit dem Niedersachsen-Plan versucht Weil nun das Heft des Handelns wieder in die eigene Hand zu bekommen.
Die Sorge der Kanzlerin, dass bei einem vorschnellen Öffnen die Lage kippen und das Gesundheitssystem bei einer zweiten Welle plötzlich doch noch an seine Grenzen geraten könnte, ist allzu verständlich.
Für den Plan spricht, dass die Menschen natürlich eine Öffnungsperspektive benötigen, und es ist ein Versäumnis aller Länder und des Bundes, diese bisher nicht geliefert zu haben. Die Sorge der Kanzlerin, dass bei einem vorschnellen Öffnen die Lage kippen und das Gesundheitssystem bei einer zweiten Welle plötzlich doch noch an seine Grenzen geraten könnte, ist allzu verständlich. Dennoch hat sich die Stimmung draußen auf der Straße verändert. Die Krankenhäuser sind leer, die Zahl der Infizierten liegt in Niedersachsen bei gut 0,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Im Supermarkt, an der Tankstelle oder auch in der Bahn auf einen Corona-Infizierten zu treffen ist in etwa so wahrscheinlich wie ein Millionengewinn im Glücksspiel. Natürlich ist das nicht die Währung, die zählt, weil es vielmehr darum geht, exponentielle Entwicklungen, die das Gesundheitssystem in die Überforderung treiben, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Aber die Lage beeinflusst die Stimmung. Und wer die Virus-Katastrophe in Italien und Spanien nicht am eigenen Leib erlebt und vor Ort hat, für den ist die Gefahr in Deutschland gerade in etwa so weit entfernt wie Papenburg von Palermo.
16 Länder-Sonderwege bei Öffnungsstrategien werden mit Sicherheit auf ebenso große Skepsis stoßen wie das jahrelange Gezänk um die föderalen Strukturen in der Schulpolitik.
Gleichzeitig darbt die Wirtschaft, Kurzarbeit grassiert und in vielen Unternehmen wachsen berechtigterweise die Sorgen, ob man den Motor in diesem Jahr überhaupt noch einmal zum Laufen bekommt oder ob man sich nicht gleich beim Amtsgericht schon mal vorsorglich einen Insolvenzantrag besorgen sollte. Dieser Spagat lässt sich über einen größeren Zeitraum nicht aufrecht erhalten. So positiv nun aber der Plan der Landesregierung für die Menschen und die Unternehmen in Niedersachsen ist, weil er endlich eine zu lange vermisste Orientierung bietet, so nachteilig ist die schon fast trotzige Reaktion aus der Staatskanzlei mit Blick auf alle 16 Bundesländer.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Soundcloud zu laden.
Die Gefahr, dass es am Ende 16 eigene Wege der Öffnung geben könnte, ist inzwischen größer geworden und droht das Vertrauen in die Landesregierungen und auch die Bundesregierung zu unterminieren. Auch wenn man es sich in der Politik vielleicht schwer vorstellen kann: Die Bürger befassen sich nicht jeden Tag mit den Gegebenheiten des Föderalismus. Sie fordern ein, dass in Deutschland Herausforderungen angepackt und praktisch gelöst werden und haben mit Sicherheit auch Verständnis für graduell abweichende Regelungen, die sich natürlich regional auch am Infektionsgeschehen orientieren müssen. 16 Länder-Sonderwege bei Öffnungsstrategien werden aber mit Sicherheit auf ebenso große Skepsis stoßen wie das jahrelange Gezänk um die föderalen Strukturen in der Schulpolitik.
Der Niedersachsen-Plan könnte der Anstoß dafür gewesen sein, dass der „normale“ Alltag in Corona-Zeiten in unterschiedlichen Ländern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten wieder einkehrt. Das wird den Druck auf dem Kessel noch erhöhen.
In welchem Bundesland kann man wann eine Ferienwohnung buchen? Wo darf ich zu fünft in den Park und wo nur zu zweit? Wo werden Freizeiteinrichtungen wann geöffnet? Auf diese ganze praktischen Fragen gibt es möglicherweise bald je nach Bundesland und Zeitpunkt ganz unterschiedliche Antworten. Der Niedersachsen-Plan könnte der Anstoß dafür gewesen sein, dass der „normale“ Alltag in Corona-Zeiten in unterschiedlichen Ländern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten wieder einkehrt. Das wird den Druck auf dem Kessel noch erhöhen und die Landesregierungen noch stärker unter Druck setzen, weil immer die Frage im Raum stehen wird: Was macht der Nachbar und warum macht er das?
Gut gemeint ist eben häufig nicht gut gemacht: Wer zu Beginn der Krise am Föderalismus seine Zweifel hatte, weil es nicht nur naturgemäß hier und da kleinere Pannen gab, sondern auch immer wieder einzelne Länder vorpreschten, wird sich nun bei der Öffnung erst Recht die Augen reiben. Niedersachsen hat mit dem eigenen Plan dem Föderalismus einen Bärendienst erwiesen.
Zugleich ist der Zentralismus natürlich nicht die Lösung, das ist gerade an der Entwicklung der vergangenen Monate in Frankreich beispielhaft zu sehen. Aber ein zerfaserter Föderalismus, in dem jedes Bundesland am Ende seinen eignen Weg geht und in dem – noch eine Ebene tiefer – jeder Bürger entweder Glück oder Pech hat, weil das örtliche Gesundheitsamt gut aufgestellt und geführt ist oder eben nicht, kann auch keine Lösung sein. Im Modell des Föderalismus fehlen die harten Prüfinstanzen, die das Vorgehen im Blick haben, bewerten und für Verbesserung sorgen. Ohne ein anständiges Controlling und angesichts des aktuellen Auseinanderdriftens gilt derzeit nach der Entscheidung in Niedersachsen derzeit auch für den Föderalismus: gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht.
Mail an den Autor des Kommentars
Contra: Der „Stufenplan“ der niedersächsischen Landesregierung ist nur bedingt ein „Vorpreschen“, denn in Wahrheit legen Weil und Althusmann nur fest, was in allen übrigen Ländern so früher oder später auch passieren wird. Das ist auch kein Skandal, denn das gute am Föderalismus ist die Ortsnähe und die regionale Flexibilität. Dieses Zusammenspiel der Kräfte hat in der Krisenbekämpfung bisher viel besser funktioniert als es in vielen Medien bewertet wird, meint Klaus Wallbaum.
Die zugeschriebenen Rollen in der medialen Wirklichkeit sind manchmal höchst ungerecht. Da erscheint jemand als „Getriebener“, obwohl er sich nur an die Vereinbarungen hält und nicht aus der Gruppe ausbrechen will. So widerfuhr es in den vergangenen Wochen mehrfach der niedersächsischen Landesregierung, und oft wurde dieser Zustand mit dem Stil von Ministerpräsident Stephan Weil erklärt. Der neige eben zum nüchternen Verwalten und nicht als Visionär oder großer Reformer. Wenn auch der Stil des Regierungschefs damit richtig beschrieben ist, so war doch das Urteil „Getriebener“ zu hart. Denn Weil, Althusmann und die Ministerkollegen wirkten medial nur deshalb blass, weil andere wie Markus Söder, Armin Laschet oder Tobias Hans forscher agierten, mit flotten Interviews Aktivismus versprühten und mit ihren vereinzelten Abweichungen von der großen Linie so taten, als scherten sie sich einen Teufel um die Kanzlerin und die Amtskollegen in den anderen Landeshauptstädten.
Das „Vorpreschen“ besteht bei näherem Hinsehen also vor allem darin, die erwartete Entwicklung als erste offen benannt zu haben.
Was das angeht, haben Weil und Althusmann nun nachgeholt. Sie tun jetzt auch mal so, als interessiere sie das Bund-Länder-Gespräch am heutigen Mittwoch einen feuchten Kehricht. Ein Teil der politischen Akteure und medialen Begleiter findet das prima, der andere Teil sieht darin einen Sündenfall. Immerhin hat die Landesregierung damit geschafft, aus der gefühlten Defensive herauszukommen, und das war es wohl wert. Wie aber steht es um die Sache, ist das „Vorpreschen“ Niedersachsens ein Schaden für das Ziel, die Menschen in der Bundesrepublik zu überzeugen von der Notwendigkeit, in schwierigen Zeiten wie diesen Einschränkungen ihrer Grundrechte hinzunehmen?
Wenn man auf die Details schaut, fällt auf, wie vorsichtig und zurückhaltend der Niedersachsen-Plan klingt. Die 800-Quadratmeter-Obergrenze für Geschäfte stand sowieso auf der Kippe, seit Nordrhein-Westfalen sie schon ausgesetzt hatte, die Öffnung von Gaststätten und Hotels war nur eine Frage der Zeit, die Wiederbelebung des Tourismus ebenfalls. Und dass man die Kleinkinder nicht länger von den Kindergärten und Spielplätzen würde abhalten können, war auch allen klar. Das einzige, was forsch klingt am Plan von Weil und Althusmann, ist die klare Terminierung. Aber auch dort ist nichts Revolutionäres dabei, wenn man bedenkt, dass mehrere andere Länder intern genau diese Zeitspannen – etwa für die Gastronomie – schon vor Tagen vereinbart hatten. Das „Vorpreschen“ besteht bei näherem Hinsehen also vor allem darin, die erwartete Entwicklung als erste offen benannt zu haben.
Das führt nun zu der Frage, wie schädlich es tatsächlich war, dass einzelne Länder in den zurückliegenden Wochen immer mal wieder aus der Reihe getanzt waren und eigene Wege versuchten, was die Kanzlerin zum Wutausbruch über „Öffnungsorgien“ veranlasst haben soll. Zum einen sind Länder-Variationen überhaupt nicht schlimm, wenn man bedenkt, dass das Virus in verschiedenen Regionen unterschiedlich stark in Erscheinung trat und manche Landkreise daher die Auflagen verschärften. Was den Kreisen zugestanden wird, muss auch den Ländern erlaubt sein. Schädlich wäre allein ein Wettbewerb um Überbietungen, der sich von der Sache, hier der Pflicht zum Seuchenschutz, entfernt – etwa mit dem Ziel des Popularitätsgewinns der handelnden Politiker.
Mag sein, dass Merkel das Laschet oder etwa auch Söder unterstellen wollte. Gemessen an den Abweichungen vom großen gemeinsamen Weg sind aber die Länder-Unterschiede bisher auch in München und Düsseldorf so minimal gewesen, dass der Vorwurf selbst nicht überzeugend ist. Mit einer Ausnahme: Seit sechs Wochen etwa gilt in Deutschland ziemlich einheitlich bisher die Regel, dass nur zwei Menschen draußen gemeinsam unterwegs sein dürfen – also ohne den Abstand von anderthalb Metern. Ausnahmen gibt es für Menschen, die in einer Wohnung leben. Nun hat Sachsen-Anhalt dieses Grundprinzip, das die Abstandsregeln in der Öffentlichkeit überhaupt erst anwendbar macht, kurzerhand gekippt und Treffen von fünf Personen zugelassen. Das war ein Tabubruch in einem ganz zentralen, wichtigen Element der Corona-Kontaktverbote – und der hätte nicht passieren dürfen.