Franz-Rainer Enste arbeitet als Beauftragter der Landesregierung zum Thema Antisemitismus. Der promovierte Jurist hat über viele Jahre als Sprecher des Landtags und später als Regierungssprecher gearbeitet, er ist ein leidenschaftlicher Verfechter der parlamentarischen Demokratie. Im Interview mit dem Politikjournal Rundblick äußert er sich zu aktuellen Entwicklungen, die ihn besorgt werden lassen, wie er sagt.

Rundblick: Herr Enste, als Antisemitismus-Beauftragter sind sie konfrontiert mit Hass und persönlichen Attacken auf hier lebende Jüdinnen und Juden, auch mit einer wachsenden Gewaltbereitschaft. Wie erklären Sie sich die in jüngster Zeit wieder spürbarere Judenfeindlichkeit in Deutschland?
Enste: Es bildet sich darin die aktuelle Krise unserer parlamentarischen Demokratie ab. Der große Vorzug der demokratischen Entscheidungswege, nämlich das Vortragen von unterschiedlichen Meinungen, die Diskussion darüber und die anschließende Suche nach einem möglichen Konsens, wird von vielen Menschen gegenwärtig nicht mehr als solcher gesehen. Wir erleben eine Radikalisierung.
Rundblick: …und diese führt dann am Ende zu Gewaltexzessen?
Enste: Es ist ganz wichtig, die Hintergründe von Ereignissen aufzuklären. Was führte dazu, dass der Täter, der am 9. Oktober 2019 auf die Synagoge in Halle einen Terroranschlag verübte, sich selbst radikalisiert hat? Was hat ihn dafür anfällig gemacht?
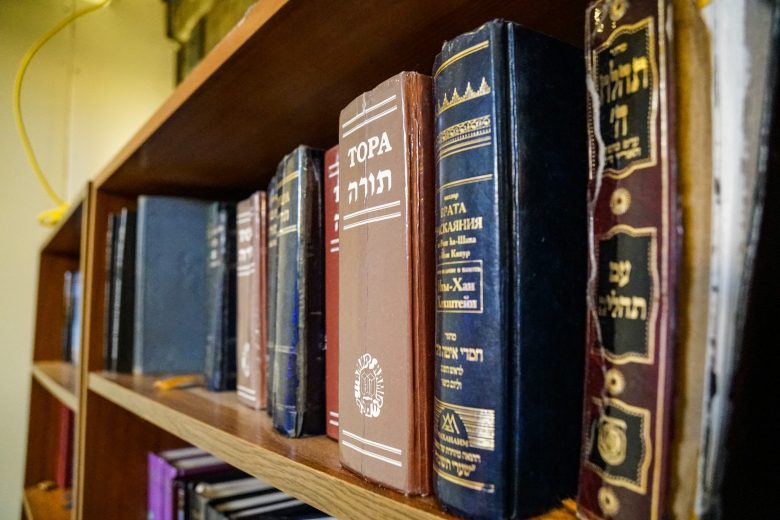
Rundblick: Sie vertreten die These, dass eine solche Entwicklung auch mit Versäumnissen früherer Generationen zu tun haben kann…
Enste: So ist es. Ich hatte die Freude, mit vielen anderen zusammen an der Erforschung der Geschichte der Gemeinde Wedemark zwischen 1930 und 1950 mitzuwirken. Dabei haben wir uns konzentriert auf die Opfer des Nationalsozialismus – und wir haben gemerkt, dass in der Euphorie des Wirtschaftswunders in der Nachkriegszeit eben Vieles „verbuddelt“ und verdrängt worden ist. Diese früheren Versäumnisse fallen uns heute auf die Füße.
Rundblick: Wieso?
Enste: Weil die Erinnerung an das, was geschehen ist, von zentraler Bedeutung für die Grundlagen unserer heutigen Gesellschaftsordnung ist. Karl Jaspers hat mal gesagt: „Was geschah, ist Warnung. Sie zu vergessen, ist Schuld. Es war möglich, was geschah, und es bleibt jederzeit wieder möglich.“ Damit ist für mich klar: Erinnerungskultur muss immer auch ein Lernimpuls bei der Ausbildung zur Zivilcourage sein.
Rundblick: Wie beurteilen Sie das vor dem Hintergrund der Corona-Krise?
Enste: Wir müssen uns gerade jetzt fragen, wie sich die Gesellschaft nach dem Ende der Pandemie verändern wird. Werden wir uns womöglich dauerhaft an die Einschränkung von Grundrechten gewöhnen – und etwa Versammlungen von vornherein meiden? Was heißt das für die Landtage, wenn sich der Eindruck verfestigt, die Entscheidungen würden sowieso auf Konferenzen der Regierungschefs von Bund und Ländern fallen? Werden wir eine bisher nicht für denkbar erachtete digitale Überwachung der Menschen erleben – und eine Hegemonie von Big Data? Bestimmt die Künstliche Intelligenz künftig unsere Produktion? Geht uns die ökonomische Basis des Wohlstandes verloren, sodass kein Geld mehr für den Sozialstaat übrig bleibt?
Rundblick: Das klingt sorgenvoll…
Enste: Ist es auch – mit Blick vor allem darauf, dass angesichts von Ungewissheiten und Umwälzungen auch eine bedenkliche Rückkehr von autoritären und autokratischen Denkweisen zu bemerken ist, ebenso von antiparlamentarischen Attitüden. Das liegt zum Teil auch daran, dass die Pandemie einen „Abschottungsmodus“ ausgelöst hat, viele Menschen nun den Blick auf das Innere des Lebensumfeldes richten und dabei Risse in den vormals einigermaßen homogenen Gesellschaften erkennen. Die Bindungswirkung von Parteien, Kirchen und Vereinen nimmt spürbar ab. Interessen werden atomisiert, das Miteinander-Ringen um den besten Weg, vorzugsweise in der Volksvertretung, gerät zunehmend in den Hintergrund. Immer mehr dünkelhaft naserümpfende, despektierliche Attitüden gegenüber dem „Politikbetrieb“ sind zu hören. Das ist gefährlich.
„Für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung. Und die ist falsch.“
Franz-Rainer Enste zitiert Umberto EcoRundblick: Warum?
Enste: Stefan Zweig hat in seinem Werk „Castellio gegen Calvin“ beschrieben, was droht, wenn einer Generation die Ideale, „das Feuer und die Farben“ verloren gehen. Dann könne ein suggestiver Mann auftreten und erklären, er habe die Formel der Rettung gefunden – und schon würden ihm Massen folgen. Dabei gilt ein Satz, den Umberto Eco treffsicher formuliert hat: „Für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung. Und die ist falsch.“
Rundblick: Welchen Weg empfehlen Sie, damit die parlamentarische Demokratie wieder zu Kräften kommt?
Enste: Bisher hat noch jeder vermeintliche Heilsbringer, der den Menschen den Himmel auf Erden versprochen hat, eine Hölle erzeugt. Wir müssen unsere Staatsidee, die auf Kontrolle und Begrenzung der Macht ausgerichtet ist, offensiv verteidigen. Die Demokratie lebt vom Wettbewerb der besten Ideen, vom Wettstreit darum. Das heißt auch, dass man „Wutbürger“ fragen muss, was sie wütend macht. Mich hat das jüngste Buch von Juli Zeh beeindruckt, in dem sie von der demokratiezerstörenden Wirkung der Angst in „kippenden Gesellschaften“ berichtet. Man darf der Angst und der Angstmacherei keinen Raum geben. Wir müssen mit Überzeugungskraft eine neue Vision einer friedlichen, solidarischeren und gerechten Welt vertreten. Wir brauchen – kurz gesagt – einen neuen kraftvollen und angstfreien Glauben an die historischen Vorzüge der Demokratie.


