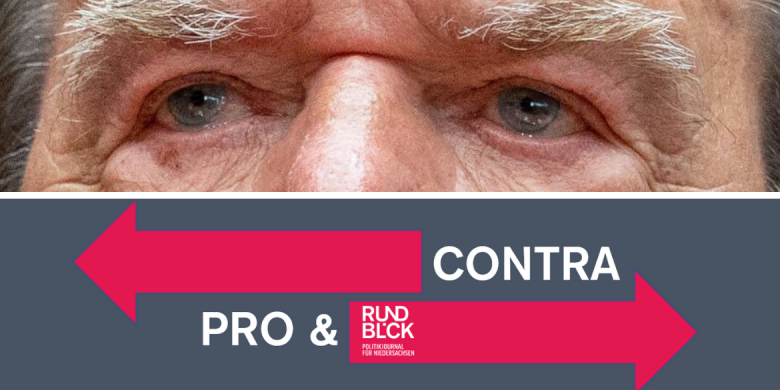
Während die ganze Welt gebannt nach Moskau blickt und rätselt, ob der russische Präsident Wladimir Putin ernsthaft seine Truppen in die Ukraine einmarschieren lassen will, gibt es neue Nachrichten über den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder. Der einstige SPD-Politiker ist für den Aufsichtsrat des staatlichen Energiekonzerns Gazprom nominiert worden, er rückt noch enger an die Mächtigen in Russland heran. Darf ein ehemaliger deutscher Regierungschef das – oder hat Schröder das seinem früheren Amt angemessene Maß an Zurückhaltung missachtet? Die Rundblick-Redaktion streitet darüber in einem Pro und Contra.
Die Rolle des Altkanzlers ist nicht definiert und auch überhaupt nicht im Grundgesetz vorgesehen. Gerhard Schröder hätte dem inoffiziellen Titel zwar eine Relevanz geben können. Das hat er aber in den vergangenen Jahren nicht getan. Welche Meinung der Privatmann Schröder zum Ukraine-Konflikt hat, ist deswegen völlig unbedeutend, meint Christian Wilhelm Link.

Als sensibel konnte man Gerhard Schröder noch nie bezeichnen. Schon als Bundeskanzler befremdete der gebürtige Westfale und Wahl-Hannoveraner viele Menschen mit seiner schnodderigen Offenheit, die ihn andererseits auch wieder authentisch machte. Da passt es irgendwie ins Bild, dass er sich auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt nicht von anderen vorschreiben lässt, was er zu tun und zu lassen hat. Und warum auch? Es gibt keinen echten Verhaltenskodex, nach dem sich Altbundeskanzler zu richten haben. Als Privatmann bleibt es Schröder selbst überlassen, ob er und wie oft er sich mit Wladimir Putin zum privaten Dinner trifft. Dass er in Bezug auf Russland zudem einen völlig anderen Kurs fährt als die SPD, ist auch kein Problem. Schließlich bekleidet Schröder kein Parteiamt mehr und wurde im Gegensatz zu Willy Brandt auch nie zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
Ich glaube nicht, dass ein Altkanzler überhaupt in der Lage ist, die Bundesrepublik nennenswert zu schädigen.
„Das Verhalten von Gerhard Schröder schadet Deutschland", echauffierte sich jüngst CSU-Parlamentsgeschäftsführer Stefan Müller. Ich glaube nicht, dass ein Altkanzler überhaupt in der Lage ist, die Bundesrepublik nennenswert zu schädigen. Wenn das wahr wäre, dann müssten sich die Vereinigten Staaten angesichts des früheren Präsidenten Donald Trump in einer fortwährenden Abwärtsspirale befinden. Umfragen zeigen dagegen sehr deutlich, dass sich nach dessen Ausscheiden aus dem Amt das internationale Vertrauen in die USA wieder deutlich erholt hat. Was ein einstiger Regierungschef sagt, ist doch höchstens innerhalb eines Nachrichtenzyklus von Interesse – wenn überhaupt. Vor allem wenn es um das weltpolitisch relativ unbedeutende Deutschland geht. Dass Schröder der kleinen Ukraine „Säbelrasseln“ vorwirft und nicht die Großmacht Russland als Aggressor wahrnehmen will, ist zwar kurios, aber nicht ernsthaft von Gewicht. Der amtierende Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der deutschen Außenpolitik, nicht der ehemalige. Und dass Schröders Aussagen für Olaf Scholz mehr sind als ein Störfeuer in weiter Ferne, glaube ich nicht.
Ein Altkanzler muss auch Meinungen vertreten dürfen, die nicht jedem gefallen. Er bekommt das Geld ja nicht für seine erlesenen Meinungsbeiträge aus dem Ruhestand heraus.
„Es wird Zeit, konkret darüber nachzudenken, Gerhard Schröder Ausstattung eines Altbundeskanzlers zu entziehen“, twitterte die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Dass sich der 77-Jährige von einem „Autokraten“ bezahlen lasse, sei nicht mit der „Apanage vom deutschen Staat“ vereinbar. Auch diese Kritik schießt weit übers Ziel hinaus. Schröder lässt sich schließlich nicht als Adeliger vom armen Volk aushalten, sondern bekommt das Ruhegehalt, das ihm laut Bundestagsbeschluss zusteht. Und ganz ehrlich: Bei gerade mal zwei lebenden Altkanzlern einem von beiden das Geld zu streichen, das wäre schon ziemlich kleinkariert. Zudem würde es einen ganz schwierigen Präzedenzfall schaffen: Ein Altkanzler muss auch Meinungen vertreten dürfen, die dem Bundestag, der Bundesregierung und vielleicht sogar dem Rest der Republik nicht gefallen. Er bekommt das Geld ja nicht für seine erlesenen Meinungsbeiträge aus dem Ruhestand heraus, sondern weil eine angemessene Pension zum wichtigsten Amt des Staates dazugehört.
Eine andere Frage ist die des Anstands. Ist es moralisch vertretbar, dass ein Altkanzler neben seinem Ruhegehalt auch noch als Lobbyist eines ausländischen Unternehmens bezahlt wird? Ganz sicher nicht. Das ist sogar richtig zynisch, wenn man bedenkt, dass die von Schröder eingeführten Hartz-IV-Gesetze quasi jeden Zuverdienst neben staatlichen Leistungen für Geringverdiener und Sozialhilfeempfänger verbieten. Für die SPD, die ohnehin im Verdacht steht, seit 1996 ihr soziales Profil stark verwässert zu haben, ist das ein Problem. Aber kein neues Problem, sondern nur eines, was die Sozialdemokraten einfach nie so richtig gelöst haben und das ihnen jetzt wieder mal auf die Füße fällt. Der Bundesrepublik kann die Causa Schröder dagegen herzlich egal sein. Die Aussagen des Altkanzlers allzu ernst zu nehmen, hieße nur, seine Rolle über Gebühr aufzuwerten. Schröder hat sich anders als sein Vorgänger Brandt im Ruhestand nicht für die Rolle des weisen Staatsmanns entschieden, sondern für die des Lobbyisten. Dementsprechend muss man ihn jetzt auch wahrnehmen und behandeln.
Die Aussage, Gerhard Schröder sei als Ruheständler ein Privatmann und könne tun und lassen, was er will, führt in die Irre. Trotzdem führt die Empörung über sein Verhalten nicht weiter, vielmehr sollte die aktuelle Bundesregierung Schröder an sein Verantwortungsgefühl erinnern und ihn für diplomatische Missionen verpflichten. Er könnte am Ende sogar nützlich werden für den Frieden, meint Klaus Wallbaum.

Hat Gerhard Schröder „Halt und Anstand verloren“, ist seine anscheinend wachsende Nähe zur russischen Machtzentrale mittlerweile „unangenehm und geschmacklos“? Diese Einschätzung hat kürzlich der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz abgegeben. Ob man ihm Recht gibt oder nicht, Merz trifft einen wunden Punkt in der deutschen Diskussion über Schröder. Dieser SPD-Politiker konnte sich schon in der Vergangenheit immer mehr herausnehmen als alle anderen. Ob als Juso-Chef, als SPD-Spitzenmann in Niedersachsen, als Ministerpräsident in Hannover oder dann als Bundeskanzler – immer wurde Schröders Wirken begleitet von Weggefährten und Journalisten, wahrlich nicht nur „linksstehenden“, die ihn verehrt, ja angehimmelt haben. Da waren das machohafte Auftreten, die Basta-Attitüde, die nur gespielte Entscheidungsfreudigkeit. Schröder galt immer als „starker Politiker“, über seine Witze lachte das Umfeld häufig und oft. Ihm ist in der medialen Wirkung über lange Zeit eine Hochachtung entgegengebracht worden, die in keinem Verhältnis stand zu den äußerst mageren Ergebnissen seiner inhaltlichen Arbeit. Staatsverschuldung, Behördenaufblähung, Reformverweigerung – das waren die Resultate bis Ende seiner Ministerpräsidentschaft 1998. Die Agenda 2010 in der Endphase seiner anschießenden Kanzlerschaft, aus der Not geboren, scheint rückblickend dann doch sehr gute Wirkungen gehabt zu haben. Doch ausgerechnet das ist ein Werk, mit dem seine eigene Partei sich nie anfreunden konnte, bis heute nicht.
Die ethischen Maßstäbe, die für ehemalige Politiker gelten müssen, hat Schröder verletzt. Kein früherer Kanzler sollte sich in den Dienst einer fremden Macht stellen.
Warum dieser Rückblick? Weil er zu erklären hilft, warum Schröder auch jetzt wieder sehr große Milde in der Beurteilung erfährt. Er war ja ein Linker, stand für viele Betrachter also auf der guten Seite. Ein konservativer Politiker dürfte sich das, was er tut, wohl kaum erlauben können. Die Selbstverständlichkeit, mit der er lukrative Posten für russische Staatskonzerne annimmt, empört nur einen begrenzten Teil der deutschen Öffentlichkeit. Jetzt, angesichts der gezielten russischen Kriegsvorbereitungen an der Grenze zur Ukraine, bekommt der Vorgang neue Brisanz. Auch dadurch, dass Schröder sich nicht zu schade ist, in Interviews die Schuld am Konflikt der Ukraine zuzuschreiben. Das alles ist ärgerlich, aber es ist die Realität.
Drei Feststellungen sind nun wichtig. Erstens: Die ethischen Maßstäbe, die für ehemalige Politiker gelten müssen, hat Schröder verletzt. Kein früherer Kanzler sollte sich in den Dienst einer fremden Macht stellen. Zweitens: Der Befund, dass Schröder dagegen fortwährend verstößt, ist nicht neu, sondern bereits Jahre alt. Die öffentliche Kritik an seinem Wirken ist Schröder herzlich egal. Drittens: Wenn er schon diese intensive Nähe zu Putin hat, dann sollte die internationale Diplomatie der nächsten Wochen den Umstand für den Zweck der Friedensmission nutzen. Man sollte Schröder für Deutschland verpflichten, statt sich weiter über seinen zweifelhaften moralischen Kompass zu empören.
Dass der Altkanzler mit seinen Auftritten die Schwäche von Olaf Scholz bloßstellt und die regierungsinternen Konflikte über die Machtverteilung damit anheizt – all das hat er selbst zu verantworten.
Die Frage, was ein früherer Kanzler darf oder nicht, ist wichtig und bedarf der Klärung. Mindestens ebenso wichtig ist aber auch die Frage, wie unter den gegebenen Bedingungen Deutschlands Beitrag zur Friedenssicherung in Europa aussehen kann. Konkret: Was kann Deutschland tun, um den russischen Machtdrang in die Schranken zu weisen? Die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP wirkt desorientiert, was an inneren Gegensätzen liegt – eine SPD mit starkem pro-russischen Flügel, einflussreiche Grüne mit stark pro-ukrainischer Ausrichtung und dazwischen ein Kanzler, der seine weltpolitische Rolle noch sucht und dafür ganz offensichtlich noch eine ganze Weile brauchen wird. Gerade jetzt, vor der französischen Präsidentschaftswahl, muss Deutschland die Leitung der EU-Außenpolitik übernehmen. Das bedeutet immer auch eine Vermittlerrolle – und was liegt ferner, als dabei auch auf Schröder zu setzen? Dass der Altkanzler mit seinen Auftritten die Schwäche von Olaf Scholz bloßstellt, seinen eigenen Parteichef Lars Klingbeil in die Bredouille bringt und die regierungsinternen Konflikte über die Machtverteilung damit anheizt – all das hat er selbst zu verantworten. Die Folgen muss die SPD ausbaden. In der gegenwärtigen weltpolitischen Lage ist das zweitrangig, gegenwärtig zählt nur eine effektive deutsche Außenpolitik. Diese ist auch Schröders Verpflichtung – gestern wie heute. Denn diese Verpflichtung gilt lebenslang für jemanden, der mal Kanzler war. Der aktuelle Kanzler sollte die Kraft aufbringen, seinem Vor-Vorgänger im Amt das deutlich zu machen.


