Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) steht protokollarisch ganz oben – neben dem Ministerpräsidenten. Seit einem Jahr repräsentiert sie Niedersachsen. Im Interview mit dem Politikjournal Rundblick setzt sich die Oldenburger Sozialdemokratin kritisch mit der Debattenkultur auseinander – und vermisst bisweilen die Offenheit, auf andere Positionen einzugehen und diese auch zu respektieren.

Rundblick: Frau Naber, der Ruf der parlamentarischen Demokratie war schon mal besser, antidemokratische Kräfte sind auf dem Vormarsch – stärker noch in europäischen Nachbarländern. Wie nehmen Sie das wahr?
Naber: In diesem Jahr lautete mein Motto: „Liebe Demokratie, bist du für alle da?“. In zahlreichen Gesprächen in ganz Niedersachsen und auf Veranstaltungen stelle ich fest, dass viele Menschen ganz angetan und überzeugt sind von unserem parlamentarischen System und seinen Spielregeln. Wenn man mit ihnen redet, kommt viel Positives zum Vorschein. Ich finde, dass zu wenig über die Vorzüge unserer politischen Entscheidungsabläufe geredet wird. Das, was nicht so gut läuft, wird breit dargestellt – auch in den Blasen, in denen sich viele aufhalten. Eine Lehre daraus ist: Jeder und jede muss sich stärker mit denen auseinandersetzen, die anderer Meinung sind.
„Das Instrument der Zwischenfrage lebt doch gerade davon, dass man unterbrochen werden kann.“
Rundblick: Wird auch im Landtag manchmal aneinander vorbeigeredet statt miteinander gerungen?
Naber: Mir steht es nicht zu, die Reden der Abgeordneten zu bewerten – das Recht der freien Rede im Parlament ist ein sehr, sehr hohes Gut. Daher nur ganz allgemein: Wir haben in der Geschäftsordnung ein paar Mittel, die eine lebendige Debatte fördern können. Das gilt etwa für die Zwischenfrage oder die Kurzintervention. Im ersten Fall kann der Redner es gestatten, dass sein Vortrag für die Frage eines Abgeordneten unterbrochen wird. Im zweiten Fall kann eine Abgeordnete unmittelbar auf das reagieren, was der gerade vortragende Redner behauptet. Beide Instrumente werden oft aber nicht genutzt, dafür hört man häufig Zwischenrufe. Diese aber stören den Redner häufig nur, statt die Debatte zu befördern.
Rundblick: Finden Sie nicht auch, dass es schade ist, wie selten Abgeordnete den Wunsch nach einer Zwischenfrage wirklich zulassen?
Naber: Die Art, wie die Mandatsträger ihre Reden halten, will ich im Einzelnen nicht kritisieren. Nur so viel: Merkwürdig finde ich es mitunter, wenn Redner im Landtag sagen, sie wollten sich jetzt nicht unterbrechen lassen und die Zwischenfrage könne ja am Ende ihrer Rede folgen. Das ist dann, wenn man es ernst meint, eben keine Zwischenfrage mehr, die eine Debatte noch bereichern kann. Das Instrument lebt doch gerade davon, dass man unterbrochen werden kann.

Rundblick: Wenn wir den engeren Kreis des Landtags verlassen und auf die gesellschaftliche Wirklichkeit schauen – nehmen Sie nicht eine Verhärtung der Auseinandersetzung wahr? Manche sagen, man dürfe nicht mehr alle Themen offen ansprechen…
Naber: Das stimmt nicht, alles kann offen angesprochen werden. Was wir aus meiner Sicht stärker benötigen, ist etwas, das in der Wissenschaft als „Ambiguitätstoleranz“ bezeichnet wird – die Fähigkeit, die Vieldeutigkeit der Welt und auch die Position des anderen zu ertragen, selbst wenn einem diese nicht schlüssig, nicht überzeugend, zu unsicher oder nicht durchdacht erscheint. Von rechts wird manchmal auf eine „Cancel Culture“ geschimpft, auf die angebliche Ausgrenzung bestimmter Debatten oder daran teilnehmender Personen. Der Boykott von Vorlesungen bestimmter Autoren etwa. Dabei sind das doch sehr wenige Fälle, wenn man es objektiv betrachtet – und oft bringt doch dieses vermeintliche Canceln gerade diesen Personen sehr viel Aufmerksamkeit. Ideologische Kampfbegriffe helfen uns dabei nicht weiter. Und: Manche Positionen sind einfach nicht tragbar, rufen Widerspruch hervor oder überschreiten „rote Linien“. Problematisch wird es, wenn berechtigte Diskussionen nicht mehr offen stattfinden können.
Rundblick: Welche zum Beispiel?
Naber: Barak Obama hat einmal gesagt, dass es auffällig sei, wie häufig gerade afro-amerikanische Kinder in den USA ohne ihre Väter aufwachsen und zu welcher Benachteiligung das führen kann. Das ist eine Behauptung, die auch durch Fakten belegt ist. Sein Appell, neben struktureller Ungleichheit auch die eigene Verantwortung der afro-amerikanischen Community in den Blick zu nehmen, hat ihm allerdings viel Kritik eingebracht. Ich finde, man muss solche Positionen öffentlich vortragen können, ohne gleich abgestempelt zu werden. Oder nehmen wir die Frauenbewegung. Dort wird diskutiert, ob eine reiche Frau das gleiche Recht hat, über Benachteiligung in ihrer gutbezahlten Arbeitsstelle zu klagen wie eine arme, ausgebeutete Frau. Wenn wir anfangen, Diskriminierungen zu hierarchisieren, einzustufen oder gegeneinander auszuspielen, dann bringt uns das nicht weiter. Der freie und offene Dialog muss die Basis für unsere Gesellschaft sein – vor allem in den Parlamenten, aber auch in den Universitäten.
Rundblick: Was können Sie denn tun, diese Leitlinie in Ihrer Arbeit zu fördern?
Naber: Die Landtagsvizepräsidenten und ich haben die Reihe „Präsidium bei Euch“ gestartet. Wir haben Schulen besucht und mit den jungen Leuten über die Arbeitsweisen der Parlamente gesprochen. Die Resonanz war sehr gut, wir haben mit diesem Format bis Anfang Dezember etwa 800 Schüler erreicht. Dabei ist immer wieder aufgefallen, wie aufgeschlossen junge Menschen reagieren, wenn man die Funktionsweisen der Demokratie ganz praktisch schildert.
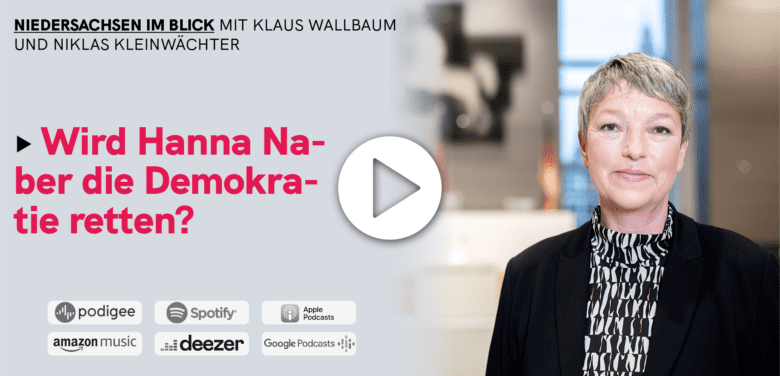
Rundblick: Kann man demokratisches Verhalten lernen – und damit auch die Achtung vor den parlamentarischen Formen?
Naber: Auf jeden Fall! Nehmen wir zum Beispiel das Wort Kompromiss. Ohne Kompromisse kommen wir in der Politik nicht weiter, der Begriff steht für etwas Positives, für die Verständigung zwischen verschiedenen Positionen. Trotzdem bekommt der Kompromiss in der Öffentlichkeit viel zu häufig einen negativen Beiklang – auch medial. Unser Ziel ist es, das bei unseren Gesprächen mit den jungen Leuten zu ändern. Meiner Meinung nach kann man den Wert der demokratischen Willensbildung, der Kompromissbildung aus mehreren verschiedenen Grundpositionen, nicht früh genug lernen. Am besten, man fängt damit schon im Kindergarten an.
Rundblick: Und in den Schulen? Kann man da beispielsweise einen Wettbewerb starten?
Naber: Warum nicht? Wenn jede Schule einmal im Halbjahr eine große Diskussionsveranstaltung plant, in der die Schüler das Debattieren lernen und im Wettstreit gegeneinander antreten, dann wäre doch schon viel gewonnen. Das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes bietet einen idealen Anlass für diese Idee!


