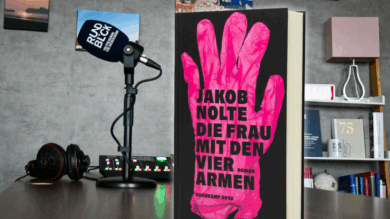Niedersachsens Landesregierung hat sich beim Ausbau der Erneuerbaren Energien eine ganze Menge vorgenommen. Im vergangenen Jahr konnten landesweit zwar 99 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 462 Megawatt Leistung installiert werden – „ein respektables Ergebnis“, sagt Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Doch wenn die Ausbauziele der nächsten Jahre erreicht werden sollen, müsse die installierte Leistung jährlich um 1,5 Gigawatt anwachsen, rechnete er am Mittwoch im Landtag vor. 2,2 Prozent der Landesfläche soll für Windparks zur Verfügung stehen, so will es auch der Bund. In welchen Landkreisen künftig wie viele Anlagen stehen sollen, wird der Minister Anfang Februar vorstellen. Flankiert werden soll dieser Schritt dann von der Einrichtung einer „Task-Force Energiewende“, deren Einrichtung der Landtag am Mittwoch mit den Stimmen von SPD und Grünen gefordert hat.
Eine wichtige Fragestellung wird es für dieses Gremium sein, wie die Genehmigung und der Bau der Anlagen tatsächlich beschleunigt werden können. Die Grünen wollen etwa, dass die Umweltverträglichkeit und der Artenschutz gleich parallel zur baurechtlichen Genehmigung geprüft werden, wie Marie Kollenrott, umweltpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, im Landtag ausführte. Hemmende Doppelstrukturen will sie beseitigen und meint: „Dann geht auch Planungsbeschleunigung und Artenschutz zusammen.“ In ihrer Rede zur „Task-Force Energiewende“ sagte die Grünen-Politikerin zudem, dass von diesem Beschluss ein Signal an die Bürger ausgehen solle, „dass eine neue Zeit anbricht“ und „dass sich das fossile Zeitalter überlebt hat“. Sie wolle über den Ausbau von Wind- und Solaranlagen hinausdenken und eine dezentrale Energieversorgung einer Bevölkerung, die sich künftig nur noch elektrische Heizungen und Autos zulegt.
„Wir können uns keine langwierigen Planungsverfahren mehr leisten.“
Um eine etwas nüchternere Betrachtung der Energiewende bemühte sich derweil die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Thordies Hanisch. „Wir können uns keine langwierigen Planungsverfahren mehr leisten“, stimmte auch sie zu. Künftig müsse es darum gehen, wie etwas möglich gemacht werden kann, und nicht mehr darum, warum etwas nicht geht. Doch selbst dann, wenn es Niedersachsen gelingen sollte, pro Jahr viermal so viele Windkraftanlagen wie bislang zu bauen, werde das nicht reichen. „Wir werden am Ende immer noch auf Importe angewiesen sein. Wir werden nicht unabhängig sein, dafür fehlt uns schlicht die Fläche“, sagte sie.
Die frühere Windpark-Planerin plädiert deshalb nachdrücklich dafür, den Ausbau der Erneuerbaren Energien um die Förderung von energieeffizienten Technologien zu ergänzen. Sie denkt dabei an Spülmaschinen, die anspringen, wenn der Strom günstig ist, oder Batterien in Privathaushalten, die sich aufladen, wenn mal viel Wind weht. Ihr Ansatz setzt vor allem auf Dezentralität und auf die Einbindung der Bürger vor Ort, vor allem im besonders vom Ausbau betroffenen ländlichen Raum. Entscheidend sei, dass die Menschen bei der Energiewende mitgenommen werden, sagte die Umweltpolitikerin der SPD-Fraktion. Doch damit das gelingt, müsse der Staat die rechtlichen Rahmenbedingungen neu setzen. „Niemand hat früher daran gedacht, dass Privathaushalte mal Energiewirte werden. In der Praxis tauchen derartige Konstrukte deshalb noch kaum auf, aber in Zukunft muss das mitgedacht werden.“ Wer eine PV-Anlage auf dem Dach habe und damit womöglich einen Dienstwagen laden möchte, der habe gemerkt, dass es da doch noch einiges Potenzial zur Vereinfachung gibt, skizzierte die Sozialdemokratin ein Beispiel dafür, wo es noch hakt. Es sei nun wichtig, für eine neue Herangehensweise aber vor allem neue Geschwindigkeit zu sorgen. Hanisch spricht sich daher für kommunale Energiegenossenschaften aus. „Es muss den Menschen so einfach wie möglich gemacht werden, Teil dieser Lösung zu werden.“
In diesem Punkt bahnt sich dann auch eine gemeinsame Ebene mit der CDU-Fraktion an. Jonas Pohlmann (CDU) sprach sich ähnlich wie Hanisch für eine „Energiewende in Bürgerhand“ aus und sagte, dies könne ein „gemeinsamer Fixpunkt“ für die CDU- und die Regierungsfraktionen werden. Allerdings übten sowohl Pohlmann als auch sein Fraktionskollege Marco Mohrmann in den gestrigen Debatten zur Energiewende auch Kritik an der geplanten Task-Force der Landesregierung. Pohlmann bemängelte, dass der entsprechende Antrag unkonkret bleibe etwa bei der Frage, welche Akteure mit eingebunden werden sollen und an welchen Stellschrauben gedreht werden müsse. „Wo werden wir schneller? Wo soll der Rotstift angesetzt werden?“, fragte er und mahnte die Regierungsfraktionen, dass auch über das Verbandsklagerecht gesprochen werden müsse. Pohlmann und Mohrmann forderten die Regierung zudem auf, den Kommunen die „Unsicherheit beim Genehmigen“ zu nehmen und klare Rahmenbedingungen zu setzen. Für die AfD-Fraktion kritisierte Marcel Queckemeyer die einseitige Ausrichtung der rot-grünen Energiepolitik auf Wind und Sonne, bedauerte den Ausstieg aus der Kernforschung und berichtete, dass in seiner Heimatregion (Kreis Osnabrück) der erste Spatenstich für den Ausbau der Energietrasse erst am Ende des Jahrzehnts geplant sei.