
einem Muster für den Politikbetrieb machen? Eine Analyse. | Foto: GettyImages/Frank Wagner
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) glaubte selbst „keinen Moment“ daran, dass es gelingen könnte: „Als Umweltminister Olaf Lies zu mir gekommen ist und sagte, er wolle Naturschutzverbände und Landwirtschaft zu einem gemeinsamen Naturschutz bewegen, habe ich ihm viel Glück gewünscht – aber insgeheim habe ich gedacht: Das klappt eh nicht.“ Diese Anekdote gab der Ministerpräsident kürzlich zum Besten, als Vertreter von Naturschutzverbänden aus der gesamten Republik im Garten des Gästehauses der Landesregierung zum Empfang versammelt waren. Anlass war der „Deutsche Naturschutztag“, der in der vergangenen Woche in Hannover ausgerichtet wurde.

Für Niedersachsens Landesregierung war es bei diesem Anlass besonders wichtig, die Erfolge des „niedersächsischen Weges“ zu erklären. Man ist da schon stolz drauf – aber man wird auch kritisch beäugt. Haben sich die Naturschutzverbände in Niedersachsen da nicht über den Tisch ziehen lassen? Hat die Landwirtschaftslobby in Niedersachsen versagt? Haben Landtag und Ministerialverwaltung sich die Zügel aus der Hand nehmen lassen? Wie so häufig bei Kompromissen gilt vielleicht auch hier: Wenn alle Seiten gleichermaßen zufrieden oder unzufrieden sind, dann ist der Kompromiss wohl geglückt. Aber was ist das Erfolgsrezept des „niedersächsischen Weges“ für mehr Artenschutz?
Viele Trampelpfade führten zum ersten Kontaktpunkt, von dem an der „niedersächsisch Weg“ begann. Dieser Punkt befindet sich geografisch betrachtet genau dort, wo Weil kürzlich die Gäste des Deutschen Naturschutztages begrüßte: im Gästehaus der Landesregierung. Am 6. Januar 2020 trafen sich dort im Kaminzimmer Vertreter aller sechs Vertragsparteien – des Umweltministeriums, des Agrarministeriums, des BUND, des Nabu, des Landvolks und der Landwirtschaftskammer. Das kann man nun abtun als simple Anekdote ohne politischen Gehalt. Doch dem ist nicht so, denn in der Politik funktioniert vieles nur mit der Kraft visionärer Persönlichkeiten. Gerade beim „niedersächsischen Weg“ mussten Parteien zueinander finden, die bislang wenig bis gar nichts miteinander zu tun hatten. Inzwischen sind die Mitglieder des Lenkungskreises gut vertraut miteinander. Diese ist eine entscheidende Basis.

Besonders herausfordernd für die vertrauensvolle Zusammenarbeit war allerdings das Artenschutz-Volksbegehren, das der Nabu mit anderen (zum Beispiel den Grünen) zur selben Zeit vorangetrieben hatte. Doch es ist auch anzuerkennen, dass es den „niedersächsischen Weg“ ohne das Volksbegehren nie gegeben hätte. Gesprächsversuche vonseiten des BUND und des Nabu mit der Politik hatte es im Vorfeld zahlreiche gegeben. Doch erst der Druck durch die Unterschriftensammlung – nachdem ein Vorläufer in Bayern überaus erfolgreich verlaufen war - brachte Bewegung in das Ganze und sensibilisierte die Politiker. Nabu-Landeschef Holger Buschmann stand dabei besonders im Fokus, denn er saß sowohl mit am Tisch des „niedersächsischen Weges“ als auch an der Spitze der Bewegung des Volksbegehrens.
Entscheidend für den Erfolg des Projektes war allerdings auch, dass Buschmann bereit war, das Volksbegehren zu beerdigen, als das Gesetzespaket zum Wasser-, Wald- und Naturschutzgesetz vom Landtag beschlossen worden war. Obwohl das Volksbegehren auf einem guten Weg war und man die benötigten Stimmen für den nächsten Schritt längst parat hatte, zog Buschmann die Notbremse – die anderen Organisatoren folgten dem. Ganz einfach war das nicht, erzählte er neulich beim Naturschutztag. Auch wenn eine Mehrheit des Nabu diesen Schritt unterstützte, gab es natürlich auch Mitglieder, die die begonnene Sache bis zum Ende durchziehen wollten. Wieso Kompromisse schließen, wenn man auch Maximalforderungen durchsetzen kann? Es brauchte also beides: den Druck und das Nachgeben.
Der Erfolg hat viele Väter, heißt es. Und das ist sicherlich auch beim „niedersächsischen Weg“ so gewesen. Doch eine Person hat sich ganz besonders damit identifiziert: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Auch wenn natürlich Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) mit involviert war, sagen die Beteiligten recht einhellig, dass die treibende Kraft der Umweltminister war. Und sie sagen, dass sämtliche Vorhaben dadurch ein anderes Gewicht bekommen haben. Ähnlich war es übrigens in Bayern auch, wo sich CSU-Ministerpräsident Markus Söder irgendwann an die Spitze der Bewegung gestellt und sich die Anliegen aus dem dortigen Volksbegehren für mehr Artenschutz zu eigen gemacht hatte.
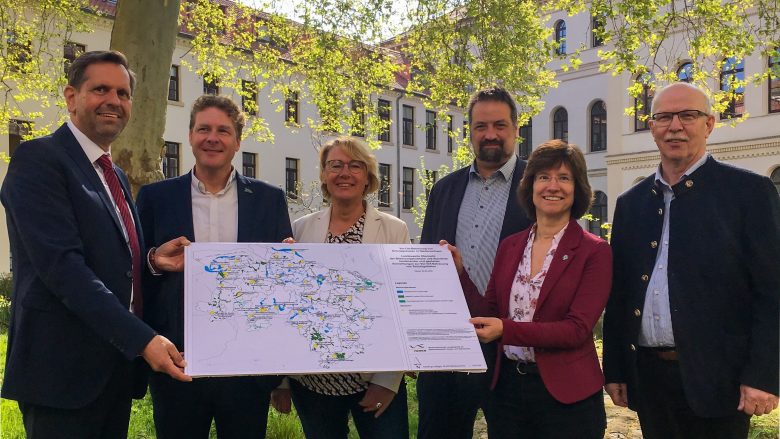
In Niedersachsen war das politische Gewicht des einflussreichen Ministers zudem von besonderer Bedeutung, weil das Verfahren so sehr vom normalen Weg der Gesetzgebung abgewichen ist, dass es mannigfaltige Hürden hätte geben können. Lies selber sagte: „Das war auch schwierig für das Haus, denn in diesem Fall hat mal nicht das Ministerium, sondern haben die Verbände die Gesetze gemacht.“ Das war in der Tat ungewöhnlich, doch für ihn genau der richtige Weg. Denn auf diese Weise hätten alle Beteiligten genau gewusst, was sie wollen und was daraus wird. Außerdem musste auch der niedersächsische Landtag mitspielen. Es hätte schließlich passieren können, dass die Parlamentarier, die bei diesem Prozess weitgehend außen vor gelassen wurden, am Ende die Zustimmung verweigern oder zumindest herauszögern. Das passierte aber nicht – und aufgrund des kooperativen Ansatzes stimmten sogar alle Abgeordneten zu.
Es sollte beim „niedersächsischen Weg“ explizit nicht so sein, dass der Umweltminister mit den Umweltverbänden und die Agrarministerin mit den Agrarverbänden spricht. Sondern der Graben sollte nachhaltig überwunden werden. Wie wichtig diese Kooperation auf Augenhöhe ist, zeigt der Blick in andere Bundesländer. Als in Bayern das berühmte Volksbegehren „Rettet die Bienen“ aufkam, dachte man beim dortigen Bauernverband noch, man könne das abwenden. Als Söder es übernahm und sogar noch weiterreichende Forderungen aufstellte, waren die Landwirte perplex und gingen auf die Barrikaden. Ähnlich war es in Baden-Württemberg auch, wo die Landwirte mit einem Gegen-Volksbegehren reagierten, wie eine Nabu-Vertreterin beim Deutschen Naturschutztag erläuterte. In Brandenburg ist die Angelegenheit gar noch verzwickter, weil dort die Politik nicht hinter dem Anliegen des Volksbegehrens steht.
Die Fronten sind verhärtet, die Landtagsjuristen versuchen, das Volksbegehren gänzlich abzubügeln. Ein Unfriede, der in Niedersachsen so nicht aufkam. Hier droht die Gefährdung eher von anderen politischen Ebenen. Landvolk-Präsident Holger Hennies muss immer wieder darauf hinweisen, dass Beschlüsse aus Berlin oder Brüssel den Artenschutzpaket aufkündigen könnten, weil Arrangements, die man in Niedersachsen getroffen hat, unterlaufen werden. Wenn man sich in Niedersachsen auf Ausgleichszahlungen oder Ausnahmen einigt, eine höhere Gesetzgebung dasselbe dann aber zur Pflicht erhebt, platzt der Vertrag.
Der „niedersächsische Weg“ ist noch nicht am Ende angelangt. Die Beteiligten hoffen, dass er noch lange weitergeht – und so ist er auch angelegt. Nach und nach sollen weitere Bereiche integriert werden. Niedersachsens Ministerpräsident Weil ist inzwischen jedenfalls von dem Format so begeistert, dass er beim Deutschen Naturschutztag den Wunsch geäußert hat, dasselbe Prinzip auch bei der Umgestaltung der Nutztierhaltung anzuwenden. „Der Grundgedanke des ‚niedersächsischen Weges‘ hat sich durchgesetzt“, konstatierte er.
In der vergangenen Woche wurde der Deutsche Naturschutztag in Hannover ausgerichtet. Rundblick-CvD
Niklas Kleinwächter moderierte ein Modul zum Thema „Vom Volksbegehren zum politisch verankerten Naturschutz“.
Neben den Protagonisten des „niedersächsischen Weges“ waren auch Gäste aus Bayern, Baden-Württemberg und
Brandenburg zugegen, um von ihren Erfahrungen mit Artenschutz-Volksbegehren zu berichten.



