
Bei der Blindverkostung von Weinen gelingt es selbst Sommeliers oft nicht mehr, die eine Sorte von der anderen zu unterscheiden. Ähnlich dürfte es erfahrenen Politikbeobachtern gehen, wenn sie nur einzelne Auszüge aus den Wahlprogrammen von SPD und Grünen betrachten. Inhaltlich sind die beiden mutmaßlichen Koalitionspartner in vielen Punkten so nah beieinander, dass man sie eigentlich nur noch durch die Begrifflichkeiten unterscheiden kann. Während es den Sozialdemokraten darum geht, Niedersachsen zum „Energieland Nr.1“ zu machen, will die Umweltpartei „das Land zu einem Vorreiter machen, das seiner Klima- und Ressourcenverantwortung gerecht wird“. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien, beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, dem klimafreundlichen Umbau von Industrie, der Digitalisierung oder auch Startup-Förderung dürfte eigentlich die einzige Herausforderung der Verhandlungsführer sein, sich auf eine gemeinsame Formulierung für den Koalitionsvertrag zu einigen. Leider droht jedoch die wohl interessanteste Idee aus dem Wahlkampf keine Berücksichtigung mehr zu finden: Der Aufbau einer Solarindustrie in Niedersachsen.
Diese Forderung von Christian Meyer, die es kurioserweise nicht einmal ins Grünen-Wahlprogramm geschafft hat, ist im Landtagswahlkampf angesichts der großen Bundesthemen irgendwie hintenübergefallen. Dabei ist die Notwendigkeit einer Renaissance der Photovoltaikherstellung in Niedersachsen selbsterklärend: Deutschland benötigt in den kommenden Jahrzehnten riesige Mengen an Solarmodulen, die bislang aber fast komplett aus China importiert werden. Das ist nicht nur wirtschaftspolitisch höchst brisant, sondern auch klimatechnisch unsinnig. Der Transport über den halben Erdball verursacht einen um 40 Prozent höheren CO2-Ausstoß als die Produktion vor Ort. Zudem gibt es in der Wirtschaft als auch beim zukünftigen Koalitionspartner SPD große Sympathien dafür, bei einer so wichtigen Industrie wieder autonomer zu werden. Wie unzuverlässig die internationalen Transportwege sind und welche dramatischen Folgen die Abhängigkeit von autoritären Staaten haben kann, müsste mittlerweile jedem klar geworden sein. Der Aufbau grüner Technologie bringt zudem nicht nur Handlungsfähigkeit, sondern auch Wirtschafts- und Innovationskraft. Die PV-Hersteller kommen allerdings nicht von allein, die Landesregierung muss dafür möglichst schnell die richtigen Voraussetzungen schaffen und auch Geld in die Hand nehmen.
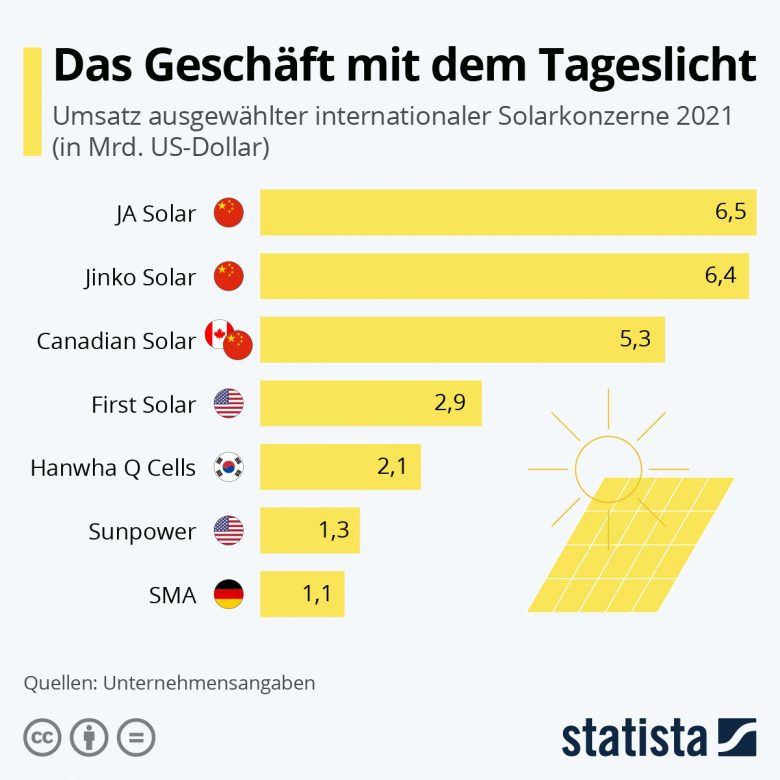
Eines ist nämlich klar: Niedersachsen braucht so viel Strom aus erneuerbaren Energien wie nur möglich – und das so schnell wie es nur irgendwie geht. Der Stahlgigant Salzgitter AG will mit dem umweltfreundlich erzeugten Strom zukünftig „grünen Stahl“ herstellen, der Volkswagen-Konzern klimaneutrale Fahrzeuge produzieren. Und das sind nur die beiden größten der insgesamt 324.000 niedersächsischen Betriebe, die ihre Produktion in den kommenden Jahren CO2-frei machen wollen und auch müssen. Mehrere Nadelöhre bremsen die Transformation der Wirtschaft jedoch schon jetzt aus: Das ausreichende Vorhandensein von grünem Strom, die Bürokratie und die Verfügbarkeit von Materialien, Fachkräften, Investitionsmitteln sowie Infrastruktur.
Die Stahlgießerei Harz-Guss in Zorge (Landkreis Göttingen) mit ihren fast 500 Mitarbeitern beispielsweise würde gerne ihre Koksöfen auf Elektroöfen umstellen. Das scheitert bislang aber allein schon daran, dass es keine Starkstromleitung in die beschauliche 1000-Seelen-Gemeinde an der Grenze zu Thüringen gibt. Und auch der jüngste Vorstoß des Stahlwerks stößt auf Hindernisse: Harz-Guss will im Südharz einen Solarpark mit einer Gesamtfläche von bis zu 200 Hektar bauen, doch dieses riesige Areal muss erst einmal gefunden werden. Auf thüringischer Seite regt sich schon jetzt Widerstand gegen den Photovoltaik-Ausbau, weil dadurch Ackerflächen verloren gehen könnten. „Die Ackerfrüchte kann ich essen, den Solarstrom nicht“, kommentierte kürzlich Stadtrat Norbert König aus Ellrich, der nördlichsten Stadt in Thüringen, die Pläne in der „Thüringer Allgemeinen“.
Niedersachsen sollte darauf hinarbeiten, dass Nutzungskonflikte nicht auch den Solarausbau hierzulande ausbremsen. Bei der Ausweisung von Freiflächen für den Photovoltaik-Ausbau müsste die künftige Landesregierung die Kommunen und Landkreise deswegen noch viel strenger in die Pflicht nehmen. Und dann sollte das Land auch über die Förderung der sogenannten Agri-Photovoltaik nachdenken, also dem Aufbau von Solarmodulen über Ackerflächen. Die Technologie wartet zwar bislang auf ihren Durchbruch, doch laut dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) sind die Potenziale enorm und die Stromentstehungskosten mit 7 bis 12 Cent pro Kilowattstunde schon jetzt wettbewerbsfähig. Der Bau einer solchen Agri-PV-Anlage ist aus baurechtlicher Sicht allerdings äußerst unattraktiv. Niedersachsen sollte deswegen Ausnahmeregelungen für die innovative Technologie beschließen und Pilotprojekte fördern. Natürlich besteht die Gefahr, dass man hier auf einen Trend setzt, der sich nicht durchsetzen wird. Die größte Sorge des künftigen Wirtschaftsministers oder der künftigen Wirtschaftsministerin sollte aber nicht sein, mit einzelnen fehlgeschlagenen Projekten im nächsten Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds zu landen, sondern dabei zusehen zu müssen, wie Niedersachsen bei Innovationen abgehängt wird.

Wirtschafts-Staatssekretär Stefan Muhle hat das Anfang des Jahres sehr treffend auf den Punkt gebracht: „Wir haben noch nicht verstanden, dass wir auch Risiken eingehen müssen, um große Chancen zu finanzieren.“ Die Hoffnung, dass die künftige Landesregierung hier mutiger vorangeht als die Große Koalition, hegen derzeit allerdings nicht besonders viele Niedersachsen – insbesondere in der Wirtschaft. Der SPD-Wahlslogan „Das Land in guten Händen“ klingt ja auch nicht unbedingt nach Innovationsfreudigkeit. Andererseits hat Ministerpräsident Stephan Weil in seiner dritten und vermutlich letzten Amtszeit als Regierungschef auch nichts zu verlieren.
Vielleicht gelingt es der SPD ja sogar, die Ressorts Wirtschaft und Energie wieder unter einem Dach zu vereinen. Mit Olaf Lies steht dafür ein Minister bereit, der dafür nicht nur die nötige Fachkompetenz mitbringt, sondern auch das nötige Standing in der Wirtschaft, der Öffentlichkeit und auch beim Koalitionspartner hat, um ein solches Superministerium zu leiten. Außerdem hat Lies immer wieder deutlich gemacht, dass er für ein ganz neues Tempo bei der Transformation der niedersächsischen Wirtschaft und Energieversorgung steht.

Für die Grünen wäre es zwar auch eine gute Gelegenheit, sich im Wirtschaftsministerium als Partei mit Wirtschaftskompetenz darzustellen. Beim Bau der LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Stade wurde allerdings auch deutlich, dass es der Umweltpartei in Niedersachsen schwerfällt, sich jederzeit hinter den pragmatischen Kurs ihres Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck zu stellen, wenn die Umweltverbände dagegen Sturm laufen. Zudem gibt es viele Ansätze in der niedersächsischen Wirtschaft, die zwar für die Wohlstandssicherung des Landes wichtig sind, mit der „grünen DNA“ aber eher weniger harmonieren.
„Viel zu lange haben CDU- und SPD-geführte Regierungen in Bund und Land versucht, etwa der für Niedersachsen besonders wichtigen Automobilindustrie zu ermöglichen, weiterhin auf Autos mit fossilen Verbrennungsmotoren zu setzen, obwohl dieser Antrieb keine Zukunft hat“, heißt es beispielsweise im Wahlprogramm der Grünen. Die Tatsache, dass viele für die niedersächsische Autoindustrie wichtigen Auslandsmärkte auch nach 2030 noch auf Verbrenner setzen werden, fällt dabei unter den Tisch. Und auch die Sympathien zu synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels), mit denen sich Verbrennungsmotoren klimafreundlich betreiben lassen, scheinen bei den niedersächsischen Grünen gering ausgeprägt zu sein. Eine der zentralen Aufgaben der neuen Landesregierung wird es sein, das Vertrauen in zukünftige Investitionen zu schaffen. Auf dem Energiesektor mag das den Grünen relativ einfach gelingen, im Industriebereich ist das Misstrauen jedoch bislang immens.



