Corona macht es den Familienhebammen schwer
„Kinderschutz bekommt immer dann Aufmerksamkeit, wenn etwas vorgefallen ist“, bemängelt Prof. Adolf Windorfer im Gespräch mit dem Politikjournal Rundblick. Dabei erinnert der Pensionär an den Missbrauchsskandal von Lügde. Doch die Gefahr einer Vernachlässigung kleiner Kinder sei nicht so selten, wie manche vielleicht glaubten. Im Jahr 2018 wurden nach Zahlen des statistischen Bundesamts in Deutschland rund 50.400 Fälle von Kindeswohlgefährdung bei Kindern und Jugendlichen festgestellt, 2019 nahmen die Jugendämter bundesweit etwa 49.500 Kinder zu ihrem Schutz in Obhut.

Aktuellere Zahlen liegen derzeit noch nicht vor, doch Prof. Windorfer weiß auch zu berichten: „Etwa 15 Prozent der Säuglinge und Kleinkinder sind von Vernachlässigung bedroht, das sind Zehntausende Kinder, für die es keine Perspektive gibt!“ Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, engagiert sich Prof. Windorfer, der von 1997 bis 2006 Präsident des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes war, schon seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Frau Celia Windorfer in der in Hannover ansässigen Stiftung mit dem Namen „Eine Chance für Kinder“.
Modell der Familienhebammen am Scheideweg
Die bisherigen Erfolge des Ehepaars Windorfer lassen sich sehen: Auf ihre Initiative geht das Modell der Fachkräfte Frühe Hilfen zurück, dass von Niedersachsen aus auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet wurde. Die Fachkräfte Frühe Hilfen sind häufig eigentlich freiberuflich oder in Teilzeit als normale Hebammen tätig, manche arbeiten auch halbtags als Kinderkrankenschwester und haben sich mit einer in Niedersachsen staatlich anerkannten Weiterbildung entsprechend qualifiziert, um sich in den Familien um die Problemlagen kümmern zu können. Ziel ist es, Eltern beziehungsweise Mütter aus prekären Verhältnissen in den ersten Monaten nach der Geburt besonders eng zu begleiten, um sie an ihre neue Rolle heranzuführen und zu unterstützen.
Dabei geht es oftmals um sogenannte Teenie-Mütter oder um Eltern, die selbst als Kind misshandelt wurden und deshalb psychische Probleme haben und nicht so einfach eine Bindung zu ihrem Kind aufbauen können. Häufig haben die jungen Mütter keinen Schulabschluss, die Zahl der Analphabeten ist hoch. Für die Kinder besteht in diesen Familien ein höheres Risiko, sich nicht gut zu entwickeln, zu wenig Gewicht zuzunehmen oder keine Bindung zu den Eltern aufzubauen. Trotz der Erfolge des Modells der Frühe Hilfen und der sogenannten frühen Hilfen erreichten die Fachkräfte Schätzungen zufolge nur sechs Prozent der betroffenen Säuglinge, berichtet Prof. Windorfer. Zudem sieht er das Modell der aufsuchenden Hilfen für junge Familien an einem Scheideweg angelangt – reicht das, was bislang geschieht? Oder zeigt die bisherige Arbeit nicht, dass eine bessere Vernetzung nötig wäre?
Anlass für diese Überlegungen ist eine Erhebung, welche die Stiftung „Eine Chance für Kinder“ seit zehn Jahren für jene Kommunen vornimmt, die Angebote zur frühen Hilfe vorhalten. Bei der standardisierten Untersuchung sollen die Erfolge des Programms hervorgehoben, aber auch Hilfestellungen und Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Trotz positiver Entwicklung, sei das vergangene Jahr allerdings für die aufsuchende Hilfe für junge Eltern und deren Kinder herausfordernd gewesen, berichtet Prof. Windorfer dem Rundblick. Die Corona-Pandemie habe zu deutlich negativen Effekten geführt. Die Häufigkeit von Gewalt in den Familien habe sich 2020 verdoppelt, heißt es in der Erhebung der Stiftung. 40 Prozent der Befragten gaben an, es habe massive Probleme beim „Umgang mit Konflikten“ oder bei „Problemen in der Partnerschaft“ (sogar 44 Prozent) gegeben. Prof. Windorfer führt diese Entwicklung darauf zurück, dass aufgrund der Homeoffice-Regelungen mehr Väter Zeit zuhause verbracht haben.
Der Vater kann eine Ressource sein, aber er kann die Hilfe auch erschweren.
In ihrer Dokumentation zitiert die Stiftung eine Fachkraft anonymisiert mit dieser Aussage, die exemplarisch für die Tendenz stehen soll: „Ich bin in den vergangenen Wochen mit zahlreichen dramatischen Notsituationen konfrontiert worden. Denn es kommt vermehrt zu erheblichen Gefährdungssituationen, vor allem zu ungezügelten Gewaltausbrüchen gegen Kinder und Frauen. Diese wissen sich nicht zu helfen.“ Aus der Untersuchung der Stiftung geht allerdings auch hervor, dass es in der Mehrzahl der Fälle gelungen ist, die Situation durch die Unterstützung der Fachkräfte Frühe Hilfen zu verbessern. Und hierbei hat die Corona-Pandemie mitunter auch wieder einen positiven Effekt, denn in zahlreichen Fällen sei es geglückt, die Väter in die Unterstützung einzubinden. Die Studie bringt diesen Sachverhalt auf die salomonische Formel: „Der Vater kann eine Ressource sein, aber er kann die Hilfe auch erschweren.“ Darüber hinaus habe es im Corona-Jahr einen besonders starken Anstieg bei Suchtproblematiken gegeben. Hier empfiehlt die Stiftung, künftig bei der Weiterbildung stärker darauf zu setzen, die Fachkräfte beim Erkennen psychischer Probleme zu schulen. Außerdem sollten die guten Kontakte beispielsweise zu den sozialpsychiatrischen Diensten der Kommunen weiter ausgebaut werden.
Da muss viel mehr getan werden. Auch das Land sollte da mehr Druck machen.
Hier ist nun der Punkt erreicht, an dem Prof. Windorfer die frühen Hilfen am Scheideweg sieht. Seit dem vergangenen Jahr drängt er vehement darauf, das Netzwerk all derer, die sich um die frühen Hilfen für Säuglinge und deren Familien kümmern, zu stärken. Psychische Erkrankungen oder gar Traumatisierungen aus der eigenen Kindheit gehörten schließlich zu den Hauptursachen für Schwierigkeiten im Umgang mit dem eigenen Kind. Prof. Windorfer wünscht sich, dass die Kooperation zwischen den Fachkräften Frühe Hilfen auf der einen und den Frauenarztpraxen, den Gesundheitsämtern und den sozialpsychiatrischen Diensten auf der anderen Seite weiter intensiviert werden. „Da muss viel mehr getan werden“, sagt er. „Auch das Land sollte da mehr Druck machen.“ Als strukturelles Problem erachtet Prof. Windorfer in dieser Angelegenheit, dass bei der zuständigen Landeskoordinierungsstelle zwei Sozialarbeiterinnen beschäftigt seien – aber dadurch die Perspektive für den Gesundheitssektor fehle. Das Team müsse anders aufgestellt werden, regt er an, zum Beispiel mit psychologisch oder medizinisch geschultem Personal.
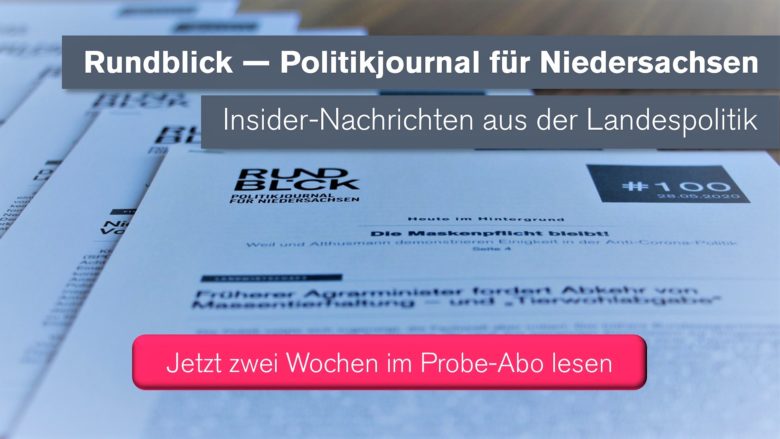
Im zuständigen Sozialministerium hat Prof. Windorfer sein dazu passendes Konzept seit September wiederholt eingereicht, wurde bislang aber nur vertröstet. Der Vorschlag werde demnächst ausführlich besprochen, antwortete man ihm. Doch derzeit ist man dort offenbar mit anderen Dingen ausgelastet. Auch im Ministerium scheint die Corona-Pandemie einer besseren frühen Hilfe für junge Familien also im Weg zu stehen.




