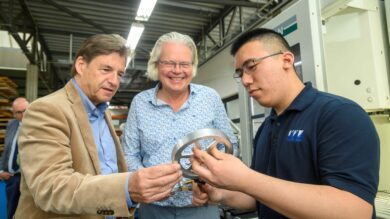Radikalenerlass-Arbeitskreis: Wer einer extremen Partei angehört, muss Beamter werden können
Selbst wenn extremistische oder systemfeindliche Parteien versuchen sollten, den öffentlichen Dienst zu unterwandern, dürfe es nicht wieder einen „Radikalenerlass“ wie in den siebziger und achtziger Jahren geben. Das erklärte Michael Höntsch, ehemaliger SPD-Landtagsabgeordneter und Mitglied des Arbeitskreises zur Aufarbeitung des Radikalenerlasses. „Wir sind uns alle einig, dass wir keine Situation mehr haben wollen, in der eine Parteimitgliedschaft den Ausschlag gibt“, betonte Höntsch. Die Journalistin Hanna Legatis, die diesem Gremium ebenfalls angehört, ergänzte: „Es gibt genügend Informationen darüber, wie sich jemand verhält. Da ist die Parteizugehörigkeit nicht entscheidend.“ Die vom Landtag berufene Landesbeauftragte für den Radikalenerlass, Jutta Rübke, erklärte: „Es ist selbstverständlich, dass die Verfassungstreue jedes Lehrers oder Juristen im Staatsdienst überprüft wird und Konsequenzen gezogen werden, wenn das Ergebnis negativ ausfällt. Aber das Verhalten muss entscheidend sein.“
Zweifel an der Verfassungstreue
Rübke war vor einem Jahr vom Landtag zur Landesbeauftragten berufen worden, zusammen mit dem Historiker Wilfried Knauer arbeitete sie die Personenschicksale von Menschen auf, die zwischen 1972 und 1990 in den öffentlichen Dienst wollten, aber wegen ihrer Zugehörigkeit zu extremistischen Organisationen das nicht durften. Der „Radikalenerlass“ von Bundesregierung und Ministerpräsidenten von 1972 hatte festgelegt, dass die Mitgliedschaft bei DKP, maoistischen K-Gruppen oder der NPD Zweifel an der Verfassungstreue der Bewerber begründet – und die Einstellung abzulehnen sei. Die Gerichte schwächten diese Linie später ab. Knauer hat in den Archiven geforscht und für Niedersachsen folgende Zahlen ermittelt: 168.931 Anfragen beim Verfassungsschutz zu Bewerbern für den öffentlichen Dienst in Niedersachsen hatte es zwischen 1972 und 1988 gegeben. In 729 Fällen hatte der Verfassungsschutz Bedenken geäußert – und in 141 Fällen wurden die Bewerber, die sich vor einer Kommission äußern mussten, auch abgelehnt. 103 von diesen 141 Personen hatten ihren Wunsch, in den Staatsdienst zu kommen, im Laufe des Verfahrens aufgegeben. Bis 1988 sind außerdem 271 Mitarbeiter des Staatsdienstes auf ihre Verfassungstreue nachträglich überprüft worden – 62 von ihnen wurden daraufhin entlassen, darunter 35 Beamte.
Lesen Sie auch:
- Betroffenenprotest: Wurden Extremisten zu Unrecht aus dem Staatsdienst ferngehalten?
- Rübke plant große Dokumentation
Die Arbeit von Rübke und Knauer wurde von einem Arbeitskreis begleitet, in dem neben Höntsch und Legatis noch Vertreter von Verdi, GEW, Universität Hannover und Konföderation der evangelischen Kirchen mitgewirkt haben. Außerdem hat es mehrere Veranstaltungen gegeben, in denen viele seinerzeit vom Radikalenerlass Betroffene aufgetreten sind. Mehrere Schicksale sind jetzt in einer 210 Seiten starken Dokumentation dargestellt. Ihren Abschlussbericht wird Rübke am Mittwoch dem Ministerpräsidenten übergeben. Sie empfiehlt darin, die Frage einer finanziellen Entschädigung für die Betroffenen zu überlegen, die schon allein durch die Überprüfung vor der Kommission ein Stigma erhalten und ausgegrenzt worden seien. Sie hätten unter einer „vergifteten Atmosphäre“ gelitten. Auch die Kommunen sollten ihre Einstellungspraxis in den siebziger und achtziger Jahren erforschen, rät Rübke – und schließlich solle die Landeszentrale für politische Bildung die Forschung vertiefen, könne das aber nur mit mehr Personal und mehr Geld auch tun.
Etwa 20 bis 30 Nachprüfungen
Knauers Nachforschungen in den Archiven förderten auch einige Besonderheiten zutage: So hat es nicht nur die bekannte Anhörungskommission gegeben, sondern offenbar daneben noch ähnliche Gremien in den Bezirksregierungen, deren Unterlagen bisher aber nicht gefunden wurden. Die landläufige Vorstellung einer verwaltungstechnisch klar gegliederten Praxis der Überprüfung stimme also wohl nicht mit der Realität überein. Außerdem spricht Knauer von „etwa 20 bis 30 Fällen“, in denen die Landesregierung über das Votum der Anhörungskommission noch einmal beriet – und in beide Richtungen die dortige Entscheidung korrigierte. In einigen Fällen seien abgelehnte Bewerber für den Staatsdienst nach der Kabinettsbefassung doch zugelassen worden, in anderen war es umgekehrt.