Sigmar Gabriel: „Ich war froh, als es vorbei war…“
Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat sich aus der aktiven Politik zurückgezogen. Aber der ehemalige Bundesaußenminister und Vizekanzler begleitet die aktuellen Vorgänge immer noch interessiert – und bereichert die Debatte hin und wieder mit eigenen Stellungnahmen. Die Redaktion des Politikjournals Rundblick hat ihn in Goslar getroffen und interviewt.

Rundblick: Herr Gabriel, wer hat jetzt eigentlich August Bebels alte Taschenuhr?
Gabriel: Welche Uhr?
Rundblick: Es heißt doch, dass die Uhr von August Bebel immer weitergegeben wird – an den jeweiligen SPD-Vorsitzenden. Da wir jetzt zwei SPD-Vorsitzende haben, fragen wir uns, wer denn die Uhr jetzt wohl haben wird. Hatten Sie sie nicht in ihrer Zeit als SPD-Chef?
Gabriel: Das ist eine schöne und trotzdem falsche Erzählung. Der erste Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, August Bebel, übrigens ein Drechselmeister, hat wohl gelegentlich Uhren verschenkt. Es gibt also mehrere und nicht die eine Uhr, die SPD-Parteivorsitzende von Bebel vererbt bekämen. Ebenso wenig wie meine Vorgänger habe ich also eine „Bebel-Uhr“ gehabt. Soweit ich weiß, gibt es eine Taschenuhr von Bebel im Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und vermutlich auch noch in russischen Archiven lagern jede Menge Gegenstände, die von der KPdSU einst gesammelt wurden als Erinnerungsstücke an die Geschichte der Arbeiterbewegung. Da steht auch ein alter Ohrensessel, in dem Karl Marx gestorben sein soll und es finden sich dort die Pistolen des Duells, in dem der zweite Gründer der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, Ferdinand Lasalle, zu Tode gekommen ist.
Rundblick: Nochmal zu Bebels Uhr: Wünschten Sie manchmal, die Zeit wäre vor einigen Jahren stehen geblieben für die SPD?
Gabriel: Nicht wenige in der SPD wünschen sich vermutlich die „guten alten Zeiten“ zurück, aber wohl weniger die Anfangsjahre der SPD-Geschichte als die Jahre mit Willy Brandt und Helmut Schmidt. Vieles wird dabei rückblickend verklärt, denn auch diese Jahre waren schwer. Man muss nur an die Gründe für Brandts Rücktritt denken oder an den RAF-Terrorismus, den Helmut Schmidt als Kanzler durchzustehen hatte. Zurückblicken ist gelegentlich ganz gut, um zu sehen, was trotz aller widrigen Umstände erreicht werden konnte. Aber nur, um Kraft für die Zukunft zu schöpfen und nicht, um sich Sentimentalitäten hinzugeben. Dafür wird man nicht gewählt.
Rundblick: Aber damals war der Begriff „Volkspartei“ für die SPD auf jeden Fall berechtigt…
Gabriel: Wenn wir die Lage nüchtern beurteilen, haben gegenwärtig doch alle sozialdemokratischen Parteien in Europa Probleme, an ihre einstige Stärke anzuknüpfen. Das Parteiensystem ist aufgefächert, die Gesellschaft ist viel individueller geworden. Selbstbestimmung und Identität sind bestimmender geworden, die Ideale von Gemeinsinn und Solidarität, für die die SPD steht, treten eher in den Hintergrund. In den vergangenen 30 Jahren galt das Motto „Öffnung der Grenzen“ – bei den Daten, beim Kapital, bei den Warenströmen und auch beim Thema Zuwanderung. Politik sollte sich möglichst raushalten, um der Wirtschaft freien Lauf zu lassen. Nun dreht sich die Stimmung, immer mehr Menschen wollen wissen: Wo sind eigentlich die Grenzen der Öffnung? Die Populisten von rechts und links reagieren mit der Illusion der Rückkehr in die scheinbare Sicherheit des Nationalstaates und mit Abschottung. Dabei vergessen sie, dass die Globalisierung ja auch viele Menschen aus bitterster Armut befreit hat und gerade Länder wie Deutschland als Exportland von ihr lebt. Es wäre also verheerend, diesem Trend zu folgen. Was fehlt ist Sicherheit für viele Menschen. Und das müssen Sozialdemokraten glaubhaft vertreten: wie schaffen wir Sicherheit, ohne dass wir uns gegen den Wandel stellen? Wie schaffen wir Sicherheit im Wandel? Das wäre eine klassische Aufgabe der SPD. Und ganz offenbar geben wir keine ausreichenden Antworten darauf, sonst sähen die Umfragen besser aus.
Natürlich hat die SPD ein Problem damit, dass sie einen populären Finanzminister nicht für geeignet hielt, die Partei zu führen, ihn aber jetzt für die Führung des Landes vorschlägt.
Rundblick: Leistet das die SPD derzeit?
Gabriel: Jedenfalls nicht hinreichend. Die steigenden Umfragezahlen für Armin Laschet und die Union hängen auch damit zusammen, dass in den Augen vieler Menschen die Christdemokraten immer schon für Stabilität gestanden haben. Da in diesem Wahlkampf bislang kaum jemand über Politik redet, spielen die traditionellen Vermutungen über Parteien und Personen eine große Rolle.
Rundblick: Warum?
Gabriel: Wenn es nicht um politische Fragen geht, spielen Personen eine größere Rolle. Man kann beides nie ganz voneinander trennen – und natürlich hat die SPD ein Problem damit, dass sie einen populären Finanzminister nicht für geeignet hielt, die Partei zu führen, ihn aber jetzt für die Führung des Landes vorschlägt. Das ist, um es mal zurückhaltend zu formulieren, ein intellektuell ambitioniertes Vorhaben. Möglicher Weise bin ich aber auch ungerecht in meinem Urteil, weil ich mir immer eine Politik wünsche, in der über die wichtigen Zukunftsfragen und die unterschiedlichen Antworten der Parteien ordentlich gestritten wird. Denn nur dieser inhaltliche Konflikt schafft ja Klarheit und Orientierung für Wählerinnen und Wähler. Aber ich gebe zu: Damit kann man sich viel Ärger einhandeln, auch in der eigenen Partei. Nur wer nichts sagt, macht auch keine Fehler und kann mit ein bisschen Glück im Schlafwagen an die Macht gelangen. Das scheint heute die durchgängige Strategie zu sein. Eine wichtige Ausnahme sind die Grünen, die ein klares Thema haben: den Klimaschutz. Ihre Klarheit und Gradlinigkeit hat sich auch für sie ausgezahlt. Allerdings sind sie durch eine Reihe von Fehlern aus dem Tritt geraten. An sich ist das schade, weil es jetzt auch hier eher um die Person von Frau Baerbock geht und nicht um das politische Anliegen.

Rundblick: Wie kann man jetzt das Beste daraus machen?
Gabriel: Wahlkampf machen und versuchen, sozialdemokratische Inhalte mit der Person von Olaf Scholz zu verbinden und mit niemandem anderen. Weder von den beiden Vorsitzenden noch von einem vielstimmigen Chor von Ministerpräsidenten oder Ministern, wenn es um die jetzt wieder aufflammenden Sorgen um die Pandemie im Herbst geht. Da muss der den Ton vorgeben, der ins Kanzleramt will und nicht noch einmal die organisierte Unverantwortlichkeit der Länder. Im Kern sollte es der SPD darum gehen, das Bedürfnis nach neuer Sicherheit nach der Pandemie aufzugreifen. Denn die Sorge um die Rückkehr der Pandemie, um den ausfallenden Unterricht für die eigenen Kinder und Enkel, um die wirtschaftliche Zukunft – all das ist ja spürbar und nachvollziehbar. Das betrifft übrigens auch die Klimapolitik: So richtig es ist, den Klimawandel zu bekämpfen, so sehr muss die Sozialdemokratie darauf achten, dass am Ende die Kosten dafür nicht die Familien oder die Rentner zu tragen haben. Eine soziale Klimawende zu formulieren, wäre den Schweiß der Edlen wert, denn das tun die Grünen nicht.
Statt über Gemeinsinn und darüber, wie wir unsere Gesellschaft zusammenhalten, reden auch wir Sozialdemokraten viel zu häufig von ‚Identitätspolitik‘ einzelner kleiner Gruppen.
Rundblick: Liegt das Problem der SPD nicht tiefer, in den Strukturen der Mitgliedschaft?
Gabriel: Alle Volksparteien haben dieses Problem, die SPD auch. Uns fehlen die berufstätigen Jahrgänge. Wir haben viele Rentner, die viel in ihrem Leben und auch für die SPD geleistet haben. Und es gibt durchaus auch viele junge Leute, die oft noch in der Ausbildung sind. Die mittleren Jahrgänge, die klassischen, allzu oft gescholtenen „Funktionäre“, die mitten im Berufsleben stehen, sind uns verloren gegangen. Sie haben früher die politischen Aussagen der Partei auf ihre „Trittfestigkeit“ und Alltagstauglichkeit überprüft und geschaut, ob die Positionen im Programm auch zur Lebenswirklichkeit der Menschen in ihrem Umfeld passen. Heute laufen wir eher Gefahr, den Anschluss an den Alltag der Menschen und ihre Sorgen zu verlieren. Statt über Gemeinsinn und darüber, wie wir unsere Gesellschaft zusammenhalten, reden auch wir Sozialdemokraten viel zu häufig von „Identitätspolitik“ einzelner kleiner Gruppen.
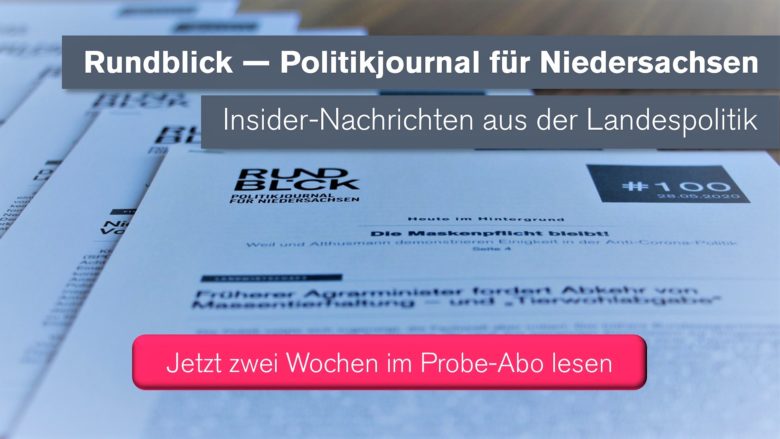
Rundblick: Was raten Sie jungen Menschen, die in die Politik gehen wollen?
Gabriel: Erstens: Schließt Eure Berufsausbildung ab und zeigt damit, dass ihr nicht von der Politik abhängig seid. Nichts ist nämlich schlimmer als die Neigung, die Ausbildung zu beginnen, dann Referent eines Politikers zu werden, die Ausbildung dann abzubrechen und später die Nachfolge dieses Politikers anzutreten. Dieser „Berufsweg“ macht abhängig vom politischen Mandat und im Zweifel passt man sich dann der aktuellen Mehrheitsmeinung in der Partei an, um wieder aufgestellt zu werden, statt für die eigene Meinung zu kämpfen. Leider haben wir davon in allen Parteien viele abschreckende Beispiele. Mein zweiter Rat lautet: Tummele Dich möglichst viel in Deinem Wahlkreis. Politik lebt nicht vom „Sitzungssozialismus“ in den vielen innerparteilichen Gremien und noch nicht einmal vom Parlament. Sie lebt davon, dass Politiker zuhören und möglichst viele Lebenserfahrungen anderer Menschen in sich aufnehmen und zu politischen Entscheidungen verarbeiten.
Meine schönste Zeit war die als Landtagsabgeordneter und Kommunalpolitiker. Bei dieser Kombination ist man am dichtesten dran an den Menschen.
Rundblick: Mehr als 40 Jahre aktive Politik liegen hinter ihnen, jetzt sind Sie eher ein Zeitzeuge, der ab und zu von außen einen Kommentar einwirft. Wenn Sie an ihre Zeit als Politiker zurückdenken, was waren die schönsten und was waren die am wenigsten angenehmen Momente?
Gabriel: Darauf habe ich eine dreigeteilte Antwort: Natürlich war meine Zeit als Mitglied der Bundesregierung die interessanteste Zeit. Denn dabei merkt man, wie groß die Bedeutung Deutschlands für viele andere Länder in der Welt ist. Das Land hat schon eine eigene Gravitationskraft, die ich vorher nicht so wahrgenommen hatte. Meine schönste Zeit aber war die als Landtagsabgeordneter und Kommunalpolitiker. Bei dieser Kombination ist man am dichtesten dran an den Menschen und vor allem merkt man schnell, ob man Erfolg hat in der Arbeit oder nicht. Man kann im wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“, was gelingt. In der Bundespolitik dauert alles unfassbar lange. Und wenn man glaubt, ein „Schiff endlich versenkt“ zu haben, taucht es kurz danach wieder auf und entpuppt sich als „U-Boot“. Die anstrengendste Zeit war die als SPD-Parteivorsitzender, weil leider progressive Parteien immer zum Jakobinertum neigen. Während die Konservativen immer regieren wollen, möchten Sozialdemokraten vor allem Recht haben. Und der innerparteiliche Kampf ist oft wichtiger als das Gewinnen von Wahlen. Davon hatte ich am Ende eine Überdosis mitbekommen und war froh, als es vorbei war.




