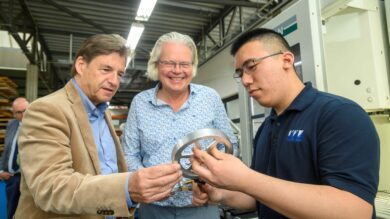„Vor einem neuen Anlauf zum Islamvertrag sollte Niedersachsen ein Gesetz beschließen“
Der frühere Ratsvorsitzende der EKD, Altbischof Wolfgang Huber, empfiehlt Niedersachsen beim Umgang mit dem Islam das Beispiel Nordrhein-Westfalen. Im Interview mit dem Politikjournal Rundblick fordert er von der evangelischen Kirche, sich klarer mit dem Islam auseinanderzusetzen und der Kritik nicht auszuweichen.
Rundblick: Herr Huber, manche Zeitgenossen meinen, man müsse das Tragen von Nikab und Burka tolerieren, denn das sei Ausdruck von religiöser Freiheit. Was denken Sie darüber?
Huber: Sowohl Nikab als auch Burka vertragen sich meiner Meinung nach nicht mit einer offenen und freiheitlichen Gesellschaft. Wir dürfen nicht aufhören, im Dialog dem anderen das Gesicht zu zeigen und als Individuen erkennbar zu sein. Die Aktion „Gesicht zeigen“ war vor einigen Jahren ein Synonym für den Streit gegen die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Das passt, denke ich, gut: Zu unserer Gesellschaft gehört der offene Dialog, das Einander-Zugewandt-Sein.

Rundblick-Redakteur Klaus Wallbaum trifft den früheren Ratsvorsitzenden der EKD, Altbischof Wolfgang Huber, zum Gespräch. Foto: Rundblick
Rundblick: Brauchen wir Gesetze gegen Nikab und Burka – und wie weit sollten diese gehen?
Huber: Ich bin nicht der, der immer gleich nach Gesetzen ruft, wenn ein Missstand in der Gesellschaft zu beklagen ist. Zuerst sind die Menschen selbst gefordert, auch die Kirche ist es. So lange sich viel zu wenig Menschen trauen, die Trägerinnen von Burka und Nikab oder ihre Begleiter anzusprechen und zu bitten, ihr Gesicht zu zeigen, ist hier noch viel zu tun. Ein Gesetz kann diesen Prozess nur unterstützen. Ich bin dafür, dass mit Blick auf den öffentlichen Dienst klare Regeln herrschen – wer etwa als Lehrer oder Beamter den Staat repräsentiert, darf sein Gesicht nicht verhüllen, schon ein Kopftuch ist hier fehl am Platze. Staatsdiener sind Diener des Staates, sie können sich in einer solchen Frage nicht auf die Religionsfreiheit berufen. Darüber hinaus finde ich den Weg, den Niedersachsen im Schulgesetz eingeschlagen hat, um das Tragen von Vollverschleierung im Unterricht zu unterbinden, richtig und wegweisend. Die Pflicht, in der Schule miteinander zu kommunizieren, wird durch eine Nikab gestört, deshalb darf diese Bekleidung unterbunden werden.
Rundblick: Reicht das schon, oder sollte man weiter gehen. Die CDU in Niedersachsen hatte vorgeschlagen, die Verschleierung in öffentlichen Gebäuden grundsätzlich zu verbieten, für jedermann…
Huber: Ich denke, es kommt auf den Zusammenhang an. Dort, wo eine Pflicht zum Austausch und zur Kommunikation besteht – etwa in Behörden, Gerichten oder Bildungsstätten – kann die neue Formulierung im Schulgesetz einen Hinweis geben, wie die gesetzlichen Regeln angepasst werden können. Aber wenn jemand nur ein Gebäude betritt und hindurchgeht, ohne dort etwas besprechen oder regeln zu wollen, wäre es nicht plausibel, ihm die Verschleierung zu untersagen. Spezielle Bekleidung als Ausdruck von Religionsfreiheit ist zu akzeptieren – aber man muss dies abwägen mit der Wirkung für ein gedeihliches Zusammenleben in der Gesellschaft.
Die Regeln müssen klar sein. – Altbischof Wolfgang Huber
Rundblick: Die Landesregierung in Niedersachsen hatte versucht, mit den Verbänden Schura und Ditib einen Islamvertrag zu schließen. Der Prozess zog sich lange hin und wurde am Ende gestoppt, auch als der zunehmende türkische Staatseinfluss auf Ditib offenkundig wurde. Sollte man einen neuen Anlauf für einen solchen Vertrag unternehmen?
Huber: Es ist notwendig, miteinander zu reden. Aber die Regeln müssen klar sein. In Nordrhein-Westfalen ist ein Gesetz beschlossen worden, dass die Möglichkeiten und Verfahren der Anerkennung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts für alle Religionsgemeinschaften und damit auch für den Islam präzisiert und erläutert – also eines Rechtsstatus, wie er der evangelischen und katholischen Kirche zuerkannt ist. Dies ist einer der Wege zur Bildung einer richtigen Religionsgemeinschaft; der andere besteht darin, von den Möglichkeiten des Vereinsrechts Gebrauch zu machen. Ich halte die gesetzliche Klarstellung in Nordrhein-Westfalen für richtig und sinnvoll, Niedersachsen könnte sich daran ein Beispiel nehmen. Den Islamvertrag mit Verbänden wie Schura oder Ditib abzuschließen, ohne dass die Muslime eigenständige Religionsgemeinschaften gebildet haben, ist der falsche Weg. Niedersachsen sollte weiter an einem Islamvertrag arbeiten – aber erst nach der Gründung muslimischer Religionsgemeinschaften. Alles andere ist unpraktikabel und wäre deshalb verkehrt.
Rundblick: Aber das dauert doch ewig, oder?
Huber: Ich habe Verständnis dafür, dass man sich gut vorbereiten muss, um rechtlich auf Augenhöhe mit dem Staat agieren zu können. Wofür ich kein Verständnis habe, ist eine Haltung, bereitgestellte Angebote einfach nicht nutzen zu wollen. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Möglichkeit, eine Religionsgemeinschaft zu gründen. Dann sollte man das auch in Anspruch nehmen. Mir haben die Islamverbände vor zehn Jahren gesagt, sie bräuchten noch Zeit für eine eigene Organisation. Jetzt heißt es wieder: Wir brauchen noch Zeit. Irgendwann muss man sich aber auch entscheiden.
Wir dürfen den Islam nicht verharmlosen. – Altbischof Wolfgabg Huber
Rundblick: Treten die christlichen Kirchen eigentlich selbstbewusst genug auf in dieser und in anderen öffentlichen Debatten?
Huber: Die Vorbehalte gegenüber dem Islam, die in Deutschland geäußert werden, sind vielfach zu pauschal und undifferenziert. Aber ich spüre auf der anderen Seite auch Verharmlosungen des Islam. Wir müssen tolerant sein, sicher. Doch das darf nicht dazu führen, dass wir keine kritische Diskussion mehr führen. Wir haben doch kein Interesse, unsere Freiheitskultur und Rechtsordnung zu ändern, nur weil eine wachsende Zahl von Muslimen in unserem Land leben will. Mir fehlt ein kritisches Denken auch auf Seiten der Kirchen. Die Kirchen sind auf religiösen Frieden aus, sie predigen Toleranz als Lebensform. Das darf aber nicht heißen, auf den eigenen Missionsauftrag zu verzichten. Vor elf Jahren gab es eine EKD-Handreichung, die sich klar von islamischen Ansichten zur Rolle der Frau distanzierte. Damals wurde der Verzicht auf eine solche Diskussion gefordert mit dem Hinweis, sie erschwere den Dialog der Religionen. Eine neue Stellungnahme der EKD zu dem Thema gibt es bisher nicht. Aber wir brauchen einen Dialog, der schwierige Fragen nicht umschifft. Wenn man solchen Fragen heute ausweicht, wird das Gespräch in zehn oder 20 Jahren, wenn viel mehr Muslime als heute in Deutschland leben, nicht einfacher werden.
Rundblick: Wie groß ist die Gefahr, dass Rechtspopulisten den Ton angeben, wie über den Islam in Deutschland gesprochen wird?
Huber: Rechtspopulisten arbeiten mit Angst – und diese Angst ist oft eine selbsterfüllende Prophezeiung. Was man meint, befürchten zu müssen, glaubt man früher oder später auch zu erleben. Hier muss widersprochen werden, doch bei der Distanzierung darf man nicht stehen bleiben. Die Kirche hat die Aufgabe, nach den Gründen für Ängste und Befürchtungen zu fragen. Nehmen Sie das Beispiel eines Vaters, der seine Tochter im Kindergarten abliefern will und miterlebt, wie die Leiterin erfährt, dass ein neues Migrantenkind in die Gruppe kommt. Der Vater ist empört, er will das Migrantenkind nicht. Als die Leiterin länger mit ihm spricht, erfährt sie, dass der Mann allein auf die Kinder aufpassen muss, da seine Frau krank ist – und dass er besorgt ist, seine Tochter erfahre nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie die Migrantenkinder. Die Leiterin kann ihm die Sorge nehmen, sie verspricht, auf seine Tochter gut aufzupassen. Daraufhin ist der Mann beruhigt. Hätte die Leiterin nicht mit ihm geredet und wäre sie nicht auf ihn eingegangen, wäre er womöglich später anfällig für die Parolen der Rechtspopulisten geworden.