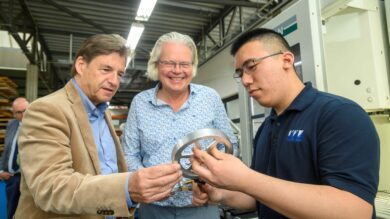Was hilft gegen die, die mit Hetze die Meinungshoheit im Netz erobern wollen?
Es war kurz vor Weihnachten, als es so richtig losging. Mit gezielten Angriffen in sozialen Netzwerken hat eine kleine aber meist anonyme Gruppe versucht, die engagierten Mitglieder der Eltern-Initiative „Familien in der Krise“ (FidK) einzuschüchtern. „Das hat sich seit dem Sommer langsam entwickelt“, berichtet Franziska Briest im Gespräch mit dem Politikjournal Rundblick. Briest ist Molekularmedizinerin und setzt sich in der Familieninitiative seit Beginn der Corona-Pandemie dafür ein, dass der Präsenzunterricht in den Schulen so lange wie möglich stattfinden kann. Nicht allen gefällt dieses Engagement, die Debatte über Schulschließungen wird nicht nur im Internet erbittert geführt. Dort hat der Diskurs aber eine gefährliche Wendung genommen. Kritiker von FidK sind dazu übergegangen, die Arbeitgeber von FidK-Aktivisten ausfindig zu machen und ihnen gegenüber Mutmaßungen über die Beschäftigten zu äußern. Wer mit seinem Namen öffentlich aufgetreten ist, riskiert eine Denunziation im beruflichen Umfeld.
Kurz vor Weihnachten wurden die Attacken dann noch persönlicher. „Es wurde tief in unsere Familien hinein recherchiert und anschließend wurden Informationen veröffentlicht“, erzählt Briest. In den sozialen Netzwerken wurden Gerüchte gestreut – über Vorfälle mit dem Jugendamt oder Probleme der Kinder zum Beispiel. Allerdings seien die Behauptungen stets in Frageform gehüllt worden. So hätten die FidK-Gegner juristische Folgen abwenden wollen. Man wolle „an die Grenzen des rechtlich Möglichen gehen“, schrieb einer der Wortführerinnen bei Twitter. Zunächst haben Briest und ihre Mitstreiter noch versucht, mit Gegenrede auf derartige Kommentare zu reagieren. Irgendwann haben sie angefangen, die Accounts der Kritiker zu blockieren. Über Weihnachten musste FidK dann alle Social-Media-Accounts abschalten – sie kamen gegen den Druck einfach nicht mehr an.
Etwa zu dieser Zeit suchte die Initiative dann Unterstützung von einer professionellen Organisation: „HateAid“. Vor knapp zwei Jahren wurde die Hilfsorganisation mit Sitz in Berlin gegründet, sie hat sich auf den Kampf gegen Hassgewalt im Netz spezialisiert. In der Beratungsstelle gegen digitale Gewalt arbeiten mittlerweile 28 Mitarbeiter – und sind bundesweit im Einsatz. Die Organisation selbst bietet keine Rechtsberatung, kann aber gute Kontakte zu Anwälten herstellen. Für FidK war es zudem wichtig, dass „HateAid“ sie auch bei den Prozesskosten unterstützt. Die Eltern-Initiative befindet sich formal noch in der Gründung, über Gelder verfügen die Mitglieder kaum. „HateAid“ hilft auch deshalb besonders gern bei der Finanzierung von Prozessen, weil man sich eine wichtige Wirkung von straf- aber auch zivilrechtlichen Urteilen erhofft.
Doch vor dem Rechtsstreit geht es zunächst meist erst einmal um etwas anders: „Wenn sich jemand bei uns meldet, geht es oft zunächst um eine emotional stabilisierende Erstberatung“, erzählt Josephine Ballon, bei „HateAid“ aktive Rechtsanwältin, im Gespräch mit dem Politikjournal Rundblick. Für die Betroffenen sei häufig zuerst wichtig zu wissen, wie sie nun in diesem Moment, in dieser konkreten Notlage reagieren sollten. Ballon beschreibt drei Strategien, die möglich wären: vorrübergehend zurückziehen, dagegenhalten oder auch Verbündete suchen. „Was richtig ist, hängt vom Einzelfall ab. Wir helfen dabei, die richtige auszuwählen.“
In einem zweiten Schritt geht es dann um den Schutz der Privatsphäre – das kann aber auch präventiv geboten sein. Die IT-Spezialisten von „HateAid“ helfen dabei herauszufinden, welche Daten über die eigene Person im Internet verfügbar sind. Die Hetzer im Netz nutzen persönliche Daten, um eine Drohkulisse aufzubauen – je mehr Informationen sie bekommen können, desto größer ist die Angst der Opfer vor einer Konsequenz im realen Leben. „Wir raten auch zu Melderegistersperren“, sagt Ballon. Es sei in Deutschland sehr einfach, eine Abfrage beim Einwohnermeldeamt zu tätigen. Da reiche häufig schon der Name und das Geburtsdatum der Person oder eine frühere Anschrift, berichtet sie. Es werde zwar nach einer Begründung gefragt, doch wird diese selten überprüft.
Das Ziel der Hetzer im Netz ist es, den politischen Gegner so sehr einzuschüchtern, dass er oder sie sich gar nicht mehr traut, sich öffentlich zu äußern. Ziehen sich die Betroffenen dann nach und nach aus dem Netz zurück, entsteht dort ein verzerrtes Bild von der politischen Meinungslandschaft. „Es wird versucht, den Diskurs im Netz zu manipulieren“, sagt Ballon. Dadurch verschiebe sich dann auch der gesamtgesellschaftliche Diskurs, weil sich dieser inzwischen stark aus dem Internet ableite. Es wurde etwa schon festgestellt, dass auch Journalisten über bestimmte Themen nicht mehr (namentlich) berichten wollen, weil sie Anfeindungen fürchteten. Briest von FidK weiß auch aus persönlicher Erfahrung von Forscherkollegen zu berichten, die inzwischen die öffentliche Diskussion von wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Covid-19-Pandemie in den sozialen Medien einschränken, weil sie sich nicht der Bedrohung durch Hetze im Netz aussetzen wollen.
Die Elterninitiative ist nur Beispiel unter vielen. Vor allem seit dem Jahr 2015 – im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise – ist eine Verrohung der Sprache im Netz festzustellen und das Gefühl entsteht, dass sich dies auch auf die reale Welt überträgt. Angegriffen wurden vor allem jene, die sich für soziale oder demokratische Anliegen eingesetzt haben. Opfer seien häufiger Frauen als Männer – wer in der realen Welt zu einer marginalisierten Gruppe gehöre, werde auch im Netz eher angegriffen, berichtet Ballon. Sie verweist zudem auf eine BKA-Statistik aus 2019, aus der hervorgehe, dass Hass und Hetze im Netz vor allem aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum kommen. Eine vollumfängliche Übersicht über das Feld gibt es allerdings nicht, weil die Kriminalitätsstatistiken der Länder nicht einheitlich sind und Straftaten im Netz unterschiedlich oder gar nicht abbilden.
In der Corona-Pandemie kommt der Hass offenbar von verschiedenen Richtungen des politischen Spektrums und bildet damit auch die Extreme zwischen Corona-Leugnung bis hin zu Befürwortern einer Zero-Covid-Strategie ab. So wurde beispielsweise wiederholt versucht, die Eltern-Initiative FidK eine Nähe zu Querdenkern anzudichten, auch Nazi-Vergleiche wurden bereits auf Twitter veröffentlicht. „So etwas kann man natürlich nicht so stehen lassen,“ sagt Briest, die sich auch bei den Grünen engagiert. „Wenn man aber einen großen Teil seiner Zeit damit beschäftigt ist, sich von Falschbehauptungen zu distanzieren, dann fehlt nicht nur die Zeit für eine inhaltliche Debatte, sondern auch der Fokus darauf, obwohl wir diese führen möchten und müssen.“
Inzwischen hat die Politik auf derartigen Kampagnen im Netz reagiert. Mit der Änderung der Bundesvorschriften sollen Amts- und Mandatsträger besser vor Beleidigung im Internet geschützt werden, die Netzwerke sollen verpflichtet werden, strafrechtlich relevantes Material an das BKA zu übergeben. In Niedersachsen hat das Innenministerium bereits in allgemeinen Informationsveranstaltungen versucht, gezielt Politiker und Journalisten zu sensibilisieren und zu schulen. Auch die Justiz reagierte. Nach Nordrhein-Westfalen und Hessen hat auch Niedersachsen seit dem vergangenen Jahr eine Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft.
Der Eltern-Initiative FidK hilft das allerdings noch nicht so recht. Die Rufmord-Kampagnen scheinen noch nicht strafrechtlich relevant zu sein. Dem demokratischen Diskurs schaden sie jedoch enorm.