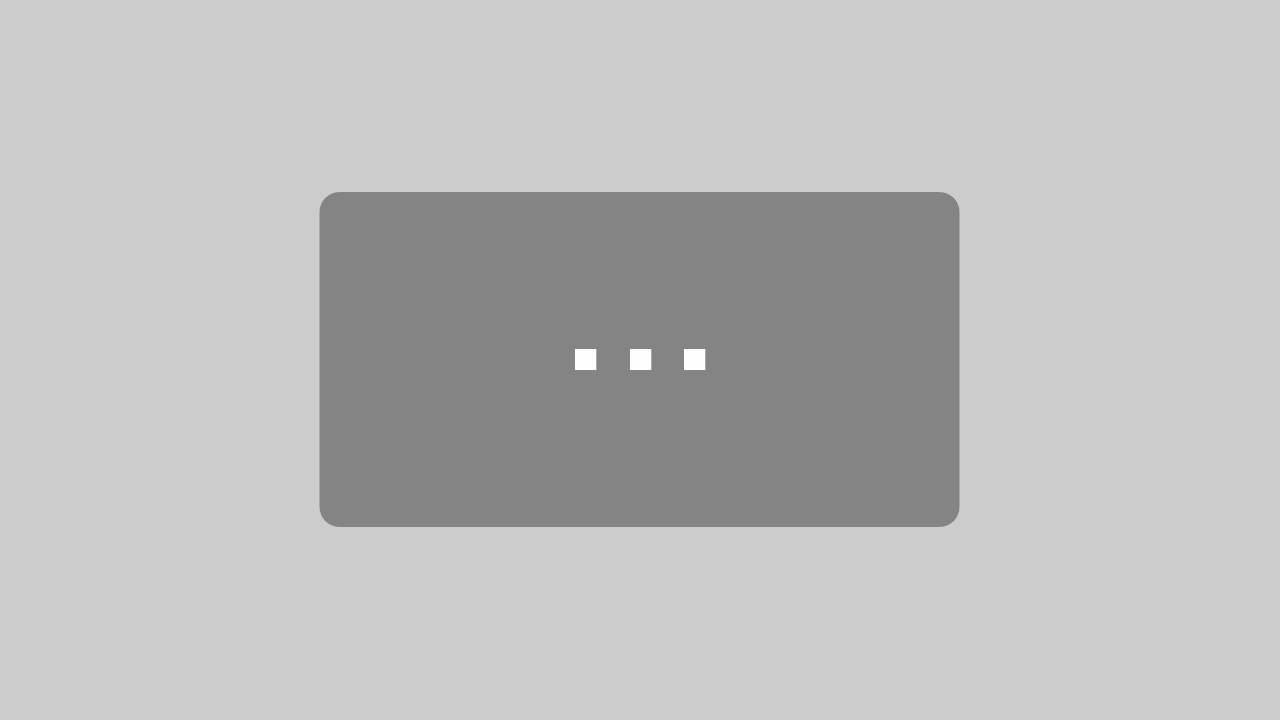„Religionen bieten eine starke Erzählung zum Tod“
Seit zehn Jahren wirkt Ralf Meister inzwischen als Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Im Gespräch mit Rundblick-Redakteur Niklas Kleinwächter spricht er über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Auseinandersetzung mit dem Sterben und die Entwicklung der Kirche in der Zukunft.

Rundblick: Im vergangenen Herbst haben Sie während eines Pressegesprächs gewarnt, unsere Angst vor Corona könnte dazu führen, dass wir den Lebensschutz über die Freiheitsrechte stellen und unser politisches System dadurch „ins Totalitäre“ abrutschen könnte. Würden Sie sich als Gegner der Corona-Maßnahmen bezeichnen?
Meister: Auf gar keinen Fall. Ohne auf einzelne Restriktionen eingehen zu wollen, würde ich sagen, dass diese Maßnahmen richtig waren. Das Wort „totalitär“ habe ich damals eher impulsiv verwendet und würde es heute nicht mehr so wählen. Worum es mir geht, ist Folgendes: Der Blick in die Welt hat gezeigt, dass autoritäre Regime, die die Freiheitsrechte längst beschnitten haben, es leichter hatten, die Pandemie einzudämmen. Wir halten die Freiheit aber von der Verfassung bis in die Lebenswirklichkeit sehr hoch. Was mich umgetrieben hat, ist die Tatsache, dass es sich bei der Corona-Pandemie um eine globale Herausforderung handelt, die niemand jemals erlebt hat, der heute noch lebt und davon erzählen könnte. Die herausfordernde Frage ist für mich: Wie reagiert eine Gesellschaft, die sich überwiegend mit dem Pathos der Freiheit definiert, auf mittel- und längerfristige Einschränkungen dieser Freiheitsrechte – wenn das eine für sie absolut ungewohnte Situation ist? Bis jetzt ist das Ergebnis aus meiner Sicht ausgesprochen gut. Kritik und Diskussionen gehören zur demokratischen Meinungsbildung in einer solchen Situation. Aber von wenigen Ausnahmen abgesehen haben wir eine große Solidarität in der Gesellschaft erlebt.
Rundblick: Nun dauert die Phase der Einschränkungen aber schon sehr lange, die Lockerungen kommen zögerlich, Existenzen sind bedroht. Fürchten Sie, dass diese Solidarität kippen könnte?
Meister: Nein, das fürchte ich nicht. Es ist ein absolut zähes Durchhalten, das stimmt. Aber die Menschen wissen, dass wir nicht mit einem Gegeneinander zum Erfolg kommen. Die Diskussion um Impfdrängler und Impfverweigerer, deren Zahl sich im Promillebereich bewegt, wurde massiv skandalisiert. Sie zeigt aber eigentlich nur die Sorge: Wer aus dieser unausgesprochenen gesellschaftlichen Vereinbarung aussteigt, dass wir es nur gemeinsam schaffen, riskiert das Ganze.
Religionen bieten starke Erzählungen zum Thema Tod, die den Menschen helfen können, besser mit Tod und Sterben umzugehen.
Rundblick: Die Corona-Pandemie hat die Themen Tod und Sterben noch einmal stärker in das allgemeine Bewusstsein gedrängt. Doch die Wahrnehmung der Todesfälle verblasst schon wieder. Blenden wir das Lebensende zu sehr aus?
Meister: Der Endlichkeitsgedanke wurde partiell wieder stärker in der öffentlichen Debatte verankert. Es wurde über medizinische Versorgung gesprochen, über Triage – und nun gibt es ein offizielles Gedenken für die Corona-Toten. Aber zur Kunst des glücklichen Lebens gehört es auch, dass der Mensch zwar vom ersten Moment an um seine Endlichkeit weiß – und trotzdem fröhlich durchs Leben gehen kann. Religionen bieten starke Erzählungen zum Thema Tod, die den Menschen helfen können, besser mit Tod und Sterben umzugehen: Es gibt ein Leben nach dem Tod. Diese Geschichte erzählen wir zu Ostern, auch wenn sie längst nicht so deutlich wahrgenommen wird wie die Weihnachtsgeschichte. Unsere Aufgabe ist es aber, dass diese Hoffnungserzählung in der Gesellschaft weiterhin wahrgenommen wird.
Rundblick: Mitten im Corona-Jahr haben Sie sich im Sommer 2020 in der Debatte zur Sterbehilfe geäußert. Bitte formulieren Sie noch einmal Ihre Position.
Meister: Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar vergangenen Jahres den Paragrafen 217 im Strafgesetzbuch gekippt. Deshalb war es notwendig, hier in eine Debatte einzutreten. Ich bin der Auffassung, dass auch kirchliche Einrichtungen nicht von vornherein ausschließen dürfen, Menschen zu helfen, die um eine Assistenz beim Suizid bitten. Diese hoch sensible Frage vom eigenen Lebensende ist so wichtig, dass sie jeder Mensch einmal für sich bedacht haben sollte. Niemand sollte sich darauf verlassen, dass die Regierung einen fertigen Referentenentwurf vorlegt und der Gesetzgeber einem die Entscheidung abnimmt. Deshalb war es mir wichtig, diese Option in die gesellschaftliche und auch in die mittlerweile sehr engagierte und differenzierte kirchliche Debatte einzubringen.
Der Bischof steht für die Einheit der Kirche. Er muss die Gemeinschaft der Menschen, die sich zur Kirche bekennen, verbinden.
Rundblick: Wie fielen denn die sonstigen Reaktionen auf Ihren Vorstoß aus?
Meister: Es gab zuerst viel Zustimmung, damit war nicht zu rechnen. Aber natürlich gab es auch viel Kritik und die habe ich ernst genommen. Die Kritik war zum einen auf die Sache bezogen, zum anderen aber auf meine Rolle. Es wurde gesagt, dass das ja meine Privatmeinung sein dürfe, dass ich mich als Bischof aber so nicht hätte äußern dürfen. In dieser Art habe ich das noch bei keinem anderen Thema erlebt. Es wäre in meinen Augen aber naiv anzunehmen, ich könnte mich hinstellen und etwas als Privatperson sagen und dann davon ausgehen, dass man diese Aussage nicht auch auf mein Bischofsamt bezöge. Ich führe diese Haltung zurück auf die historische Funktion des leitenden Geistlichen: Der Bischof steht für die Einheit der Kirche. Er muss die Gemeinschaft der Menschen, die sich zur Kirche bekennen, verbinden. Die Betroffenheit in den Rückmeldungen könnte damit zusammenhängen, dass wir beim Thema Tod über die größte Kränkung sprechen, die ein Mensch erleben kann: Das unausweichliche Ende seines Lebens. Das betrifft jeden und jede. Bei Äußerungen zur Flüchtlingspolitik oder zum interreligiösen Dialog geht es dagegen eher um Themen, die den Einzelnen nicht so absolut berühren.
Die Zukunft der Kirche beschreibe ich gerne mit drei Adjektiven: missionarisch, ökumenisch und nachhaltig.
Rundblick: Zehn Jahre sind Sie nun im Amt – wie wird die Kirche wohl in weiteren zehn Jahren aussehen?
Meister: Die Zukunft der Kirche beschreibe ich gerne mit drei Adjektiven: missionarisch, ökumenisch und nachhaltig. Zum Ersten: Wir sind kein Hobby- oder Sportverein, sondern eine Gemeinschaft mit einem klaren Auftrag, einer Schrift und einer Erzählung, die besagt, dass Gott mit uns Menschen zu tun haben will und dafür werben wir. Zum Zweiten: Die Stimme der kleiner werdenden Kirche wird nicht mehr so deutlich zu hören sein. Deshalb werden wir uns häufiger fragen, ob wir etwas als Lutheraner, als Reformierte oder als Katholiken sagen – oder nicht doch vorrangig als Christen? In den Gemeinden wird das schon in großer Selbstverständlichkeit gelebt. Zum Dritten: Wir müssen umdenken und aufhören, den Menschen noch immer als Krone der Schöpfung zu betrachten. Wir haben nicht Gott und den Menschen, sondern Gott und seine Schöpfung – und darin den Menschen. Und diese Perspektive macht demütig.