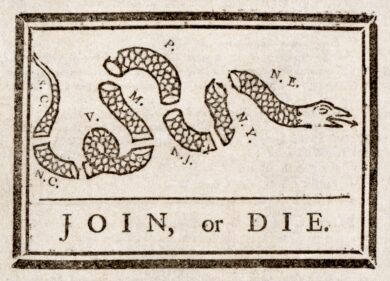Corona-Aufarbeitung (2): Verwaltung arbeitete schnell statt sauber und sät Misstrauen
Die Corona-Pandemie gilt als überwunden. Doch diese Phase mit ihren Unsicherheiten und ihren strengen Schutzmaßnahmen hat Wunden hinterlassen. Menschen wurden persönlich verletzt, ganze Bevölkerungsteile stehen einander noch immer unversöhnlich gegenüber. Eine Aufarbeitung konnte aber angesichts der neuen Krisen bislang nicht vorgenommen werden. Was kann helfen? Ein Blick auf das Narbengewebe, das sich auf der Seele der Gesellschaft gebildet hat. Heute: die Rolle der Verwaltung.

Wann hat es das schon mal gegeben? In der Bundesrepublik noch gar nicht. Sicher, eines war nicht neu: Dass eine Krise den Rhythmus der Politik bestimmt, ja beherrscht. Das kann passieren bei Naturkatastrophen, bei Überflutungen und Waldbränden, auch bei internationalen Finanzkrisen oder bei der Abwehr eines terroristischen Angriffs. Auch weltpolitische Großereignisse wie nach dem 11. September 2001 können die gesamte Politik in einen Bann ziehen und bewirken, dass sich scheinbar alles nur um dieses Thema dreht. Das war 2001 über mehrere Wochen so.
Eine gewisse Übung musste die Verwaltung also im März 2020 haben. Aber die Corona-Lage war dann doch in einer Hinsicht außergewöhnlich: Die Krisenlage, die fast die gesamte öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog, dauerte nicht nur wenige Tage, wenige Wochen oder wenige Monate – sondern Jahre. Über diese Zeitspanne befand sich die Verwaltung in einer Art Ausnahmezustand. Dadurch sind nachhaltige Störungen im Gefüge des eingeübten Meinungsbildungsprozesses entstanden. Sie wirken bis heute nach. Das soll in sechs Thesen verdeutlicht werden.
Schnelligkeit auf der Basis von Unsicherheit
Das Virus kam näher, die Wissenschaft war nicht nur ratlos – sondern in wichtigen Punkten auch noch uneinig. Das bedeutete für die Politiker, dass sie unter einem erheblichen Zeitdruck standen und auf unsicheren, teilweise nur hypothetischen Annahmen basierend weitreichende Entscheidungen treffen mussten. Sie stocherten im dichten Rauch voran in Richtung des erhofften Ausgangs, getrieben vom Feuer hinter ihnen, das immer näher kam.
Komplexität entfällt
Im normalen Meinungsbildungsprozess der parlamentarischen Demokratie gibt es mehrere Phasen. Interessengruppen artikulieren ihre Bedürfnisse, die Politiker wägen diese ab und gewichten die verschiedenen Forderungen. Jede Entscheidung kann komplizierte Folgewirkungen für mehrere Themengebiete haben – oft auch für solche, die zunächst gar nicht wahrgenommen worden sind. Um sicherzustellen, dass möglichst alle Gesichtspunkte berücksichtigt werden, dauert der Prozess mehrere Wochen. Verbandsvertreter, Juristen, Fachausschüsse der Parlamente beraten und bringen ihre speziellen Sichtweisen ein. Bevor nach zwei Lesungen im Parlament eine Entscheidung fällt, ist die Sache gründlich erörtert worden.
Niklas Luhmann hat das „Legitimation durch Verfahren“ genannt. Das lange und intensive Betrachten von mehreren Seiten soll Schnellschüsse und Fehlentscheidungen verhindern. Das klappt meistens dann, wenn dieser Prozess möglichst offen und ehrlich, möglichst objektiv und unter Einbeziehung von vielen Stimmen geschieht. Bei Corona galt das alles nichts: Der Schutz vor Ansteckung war ein so überragendes, alle anderen Interessen überlagerndes Anliegen, dass dem alles untergeordnet wurde. Mängel und Fehler wurden bewusst in Kauf genommen, weil es immer galt, Schlimmeres zu vermeiden. Entscheidungswege wurden verkürzt, wohlwissend, damit Fehler zu riskieren.
Der Blick auf die Probleme verengt sich zunächst
Wenn es nur noch darum geht, welche Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen geschlossen werden und welche Ausnahmen erlaubt werden, ist der gesamte komplexe Politikbetrieb entbehrlich. Interessengruppen, Partei-Festlegungen, Parlamente – das wird nicht gebraucht. Wenn diese Akteure sich einmischen wollten, würde es zudem viel zu lange dauern. Auch in der Exekutive, der Regierung, verengt sich die Sichtweise: Entscheidend ist der Krisenstab – genauer: der kleine Kreis von Mitarbeitern, die an der jeweils neuesten Fassung der Corona-Verordnung arbeiten. Alles kann zwar gerichtlich in Frage gestellt werden, wurde es auch. Aber auch die schnellsten Eilentscheidungen der Gerichte dauern mehrere Tage, in denen die angefochtenen Regeln schon verbindlich sind.
Der öffentliche Diskurs verengt sich ebenfalls, die mediale Aufmerksamkeit konzentriert sich auf einen kleinen Teilbereich des Verwaltungshandelns, auf Halbsätze und Interviewaussagen, auch auf Ausrutscher in der Kommunikation. Alles erfährt wegen dieser Hervorhebung wie durch eine Lupe eine riesige Aufmerksamkeit, wie im Übrigen auch die jeweils neuesten Einschätzungen der Corona-Experten. Die den Medien eigene Kunst der Überbietung und Skandalisierung trägt zur Beschädigung des Krisenmanagements bei. Viele Akteure in Verbänden, Parteien und Parlamenten, die notgedrungen außen vor bleiben müssen, halten die Krisenmanager für überfordert und verlangen, in die Entscheidungsprozesse eingebunden zu werden.
Die Ausweitung der Sichtweise fällt schwer
Wenn die wesentlichen Entscheidungen – etwa zum Lockdown – getroffen sind, müsste ein kluges Krisenmanagement eigentlich den Blick wieder weiten. Es müsste sofort mit eigenen Anstrengungen prüfen, ob die Schutzmaßnahmen (etwa Schulschließungen) richtig waren, ob es Alternativen zu den Beschränkungen gibt, ob die Ausnahmen richtig platziert sind. Dazu ist wieder eine Öffnung und Weitung der zuvor verengten Perspektive nötig, es muss Meinungsaustausch mit Wissenschaftlern, Verbandsvertretern und Politikern geben – gesteuert vom Krisenmanagement, das natürlich weiterhin allein die Handlungsgewalt trägt, denn wir befinden uns ja noch in einer Notsituation. Wichtig ist dabei, dass die Manager die Kraft zu diesem Perspektivwechsel haben. Sie hatten sie während der Corona-Krise offenkundig nicht genügend.
Die Debatte über die Frage, was nun in der Corona-Verordnung steht und was nicht, blieb im Zentrum aller Diskussionen. Dabei hätte das Krisenmanagement sich von diesem Gegenstand entfernen müssen. In der Praxis hat das nicht gut geklappt. Die Fokussierung auf die Detailregeln der Corona-Verordnung war so dominierend, dass der Blick dort hängen blieb. Befeuert wurde das durch kontroverse Äußerungen von Wissenschaftlern, die in ihrer Verkürzung und Zuspitzung gegensätzlich, widersprüchlich und verunsichernd wirkten. Man verhakte sich im Detail und gewann keinen Freiraum zur Betrachtung der Folgewirkungen des Handelns.
Weniger Akteure, mehr Misstrauen
Das Gute an den üblichen Abläufen in der parlamentarischen Willensbildung ist die Tatsache, dass bis zur Entscheidung sehr viele Mitspieler ihren Senf dazugeben konnten. So hat am Ende jeder an der Entscheidung, idealerweise an einem Kompromiss, mindestens einen kleinen Anteil. Die Corona-Krise mit ihrer notwendigen Verengung der Verantwortung auf eine kleine, schnell handlungsfähige Exekutive erzeugte aber viel Misstrauen und viel Distanz.
Die Parteien und ihre Landtagsabgeordneten, die die Regierung tragen, also in Niedersachsen SPD und CDU, waren zur Verteidigung der Corona-Krisenpolitik gezwungen. Da die meisten aber gar nicht richtig auf die Inhalte einwirken konnten, geschah die Verteidigung meistens halbherzig, oft auch auf der Basis von mangelhafter Information. Überzeugend hätten sie die Verwaltung nur dann verteidigen können, wenn sie intensiv an der Entstehung der Politik mitgearbeitet hätten. Das aber ließ die Krisensituation gar nicht zu.
Ein Langzeit-Vertrauensverlust
Anfangs fiel den Politikern die – in der Sache zwingende – Delegation von Entscheidungskompetenz auf die Exekutive schwer. Später, als die Krise sich in die Länge zog, fiel es der Exekutive schwer, den notwendigen gesellschaftlichen Dialog zu führen. In der Konsequenz haben alle Vorgänge das Verhältnis der Akteure im politischen Geschäft nachhaltig belastet. Die einen fühlen sich nicht mitgenommen, die anderen sich nicht richtig respektiert in ihrer schwierigen Rolle als verantwortliche Entscheider.
Nach außen vermittelten Politik und Verwaltung den Eindruck, mehr von der Entwicklung getrieben zu sein als diese selbst geschickt gesteuert zu haben. Das ist zwar an sich gar nicht verwunderlich, denn die Erfahrung mit so einem Virus war tatsächlich einzigartig. Aber dass die Corona-Zeit nun einen Sprung hin zu einem neuen Politikverständnis bewirkt hätte, dass man plötzlich bereit wäre, alte Zöpfe abzuschaffen (etwa übertriebenen Datenschutz bei Gesundheitsdaten), ist nur begrenzt erkennbar. Sehr viele offenbar sind froh, dass Corona überstanden ist – und wollen so weitermachen wie vor 2020.

Dieser Artikel erschien am 07.11.2023 in der Ausgabe #192.