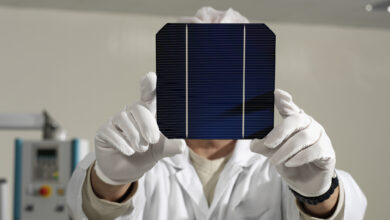Wie Zeugen vor Gericht auf einen Helfer bauen können
Von Isabel Christian
Der Anruf kommt gegen halb eins am Dienstagmittag. Ein Richter ist am Telefon, Silke Lorenz weiß, dass er gerade eine Verhandlung hat. „Entschuldigen Sie die Störung, aber könnten Sie mal eben kommen? Es gibt da ein Problem mit einer Zeugin.“ Die Zeugin entpuppt sich dann wenig später vor Ort als ältere Frau, die vor dem Richter gegen eine Betrügerbande aussagen soll. Doch sie wirkt fahrig und kann sich kaum auf die Fragen des Richters konzentrieren. Schließlich gesteht sie, vor lauter Aufregung nicht gefrühstückt zu haben und nun vor Hunger nicht richtig denken zu können. Lorenz lächelt sie freundlich an. „Hier entlang, bitte. Auf dem Speiseplan stehen heute Frikadellen.“ Beim Mittagessen in der Amtsgerichtskantine fasst die Frau schließlich Vertrauen. Sie sei auf einen Enkeltrick hereingefallen, habe 15.000 Euro verloren. „Das ist mir so peinlich, dass ich es keinem erzählt habe“, sagt die Seniorin leise. Einen Fall wie diesen haben Lorenz und ihre Kollegin Carmen Zipser selten. Meistens sind es Opfer von Vergewaltigungen, Stalking, Überfällen oder häuslicher Gewalt, die in ihr Büro im ersten Stock des Amtsgerichts Göttingen kommen und um Hilfe bitten. Doch eines haben sie mit der alten Dame gemeinsam: Für viele ist der Besuch bei der psychosozialen Prozessberatung der letzte Ausweg. Und nicht der Anfang, wie es eigentlich sein sollte.
Die Idee, die Fokussierung der Justiz auf die Täter aufzubrechen und das Opfer nicht nur als Zeugen zu betrachten, setzt sich seit der Jahrtausendwende in den niedersächsischen Strafverfolgungsbehörden immer weiter durch. 2001 richtete die damalige Landesregierung unter dem Justizminister Christian Pfeiffer die Stiftung Opferhilfe ein, die Opfern von Straftaten finanziell helfen soll. Allerdings ist es damit nicht getan, wie sich bald zeigte. Denn Opfer, vor allem nach schweren Straftaten, sind oft überfordert mit der Situation. Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden können oder müssen, welche Rechte sie haben oder wie eine Gerichtsverhandlung abläuft. „Es kommt immer wieder vor, dass wir Menschen erklären müssen, dass im Gerichtssaal nicht zwölf Geschworene sitzen, die überzeugt werden müssen“, sagt Lorenz. Um das Problem zu lösen, haben Opferhilfe und Justizministerium 2011 ein Modellprojekt gestartet: die Psychosoziale Prozessbegleitung. Mittlerweile wird sie in allen elf Landgerichtsbezirken und damit in 15 niedersächsischen Städten angeboten und ist seit Anfang 2017 auch im Bundesgesetz verankert. Es ist ein wesentlicher Fortschritt für die Prozessbegleiter, denn durch die Gesetzesänderung sind sie nun offiziell ein Teil der Opfervertretung vor Gericht. Besteht das Opfer darauf, sie während einer Vernehmung oder Verhandlung an seiner Seite zu haben, darf der Richter sie nicht des Saals verweisen. Doch die Rolle der Prozessbegleiter sorgt im juristischen Alltag immer noch für Verwirrung.
Das fängt schon damit an, dass viele Richter und Anwälte nicht genau wissen, was diese Person da eigentlich bei ihrem Zeugen oder Mandanten macht. „Früher wurden Opferrechte allenfalls von den Anwälten der Nebenklage ernst genommen, für die anderen zählte nur die Aussage“, sagt Lorenz. Vor allem in Sexualstrafverfahren setzten sich die Anwältinnen oft selbst neben ihre Mandantinnen. „Diesen Platz haben wir nun geklaut“, sagt Zipser. Doch eine juristische Rolle übernehmen die Begleiter nicht. Sie dürfen das Opfer weder rechtlich beraten, noch die Tat mit ihnen besprechen. Doch sie haben kein Zeugnisverweigerungsrecht und dürften deshalb von der Verteidigung befragt werden. Zipser und Lorenz sind sich einig, dass sie keine Zeugenrolle übernehmen wollen. „Das war in der sozialen Arbeit nie vorgesehen“, sagt Lorenz. „Wir kennen deshalb meist nur ein paar Schlagworte zu dem, was dem Opfer zugestoßen ist. Und mehr wollen wir gar nicht wissen“, sagt Zipser. Aber was tut ein Prozessbegleiter dann? Die zierliche Frau mit den wilden Locken lächelt. „Wir kümmern uns um alles drumherum.“
Zipser und Lorenz mögen das Wort „Prozessbegleiter“ nicht recht. „Da denken alle, wir seien nur für den Prozess da“, sagt Lorenz. Doch die Arbeit beginnt im Idealfall für die beiden schon vor der Anzeige und endet nach der Gerichtsverhandlung. Jeder, der Opfer einer Straftat geworden ist, hat ein Recht darauf, durch die psychosozialen Prozessbegleiter beraten zu werden. Etwa 30 Opfer begleiten Lorenz und Zipser pro Jahr, die meisten sind Frauen und Kinder. Manchmal dauert eine Begleitung nur ein paar Stunden, manchmal sind es Jahre. Beim ersten Besuch führen die beiden Sozialpädagoginnen ein Gespräch mit dem Opfer. Darin geht es hauptsächlich darum, was die Person in dieser Situation braucht. Sind es Informationen? Ein Ansprechpartner? Oder Hilfe bei der Erstattung einer Anzeige? „Manche kommen nach diesem ersten Treffen nicht mehr wieder, weil sie sich schon gut informiert fühlen“, sagt Lorenz.
Lesen Sie auch:
Einig wie selten: Pistorius und Schünemann werben kraftvoll für ein neues Polizeigesetz
Datenschutzbeauftragte rügt den Polizei-Messengerdienst
Andere brauchen mehr Beistand. „Wir helfen zum Beispiel bei der Suche nach einem Anwalt, einem Therapeuten oder bei Behördengängen“, sagt Lorenz. Muss das Opfer vor Gericht aussagen, nehmen die Frauen es in Empfang und führen es durch den Hintereingang ins Gebäude, sodass es dem Täter nicht begegnen kann. Die Wartezeit versuchen Zipser und Lorenz möglichst kurzweilig zu gestalten. Es gibt ein Familienzimmer mit Spielen und etwas zu trinken oder einen kleinen Snack. „Wir halten mit den Menschen Smalltalk, was oft anstrengend ist. Denn viele neigen dazu, ihre Aussagen proben zu wollen“, sagt Lorenz. Während der Verhandlung sitzen sie neben den Opfern, reichen Taschentücher und geben dem Richter ein Signal, wenn das Opfer eine Pause braucht. „Das hat für alle Vorteile“, sagt Zipser. Das Opfer fühlt sich nicht allein gelassen, der Anwalt kann sich ganz auf die juristische Verteidigung konzentrieren und der Richter weiß, dass sich um das Opfer auch nach der Aussage jemand kümmert.
Doch noch immer erfahren Opfer viel zu selten oder zu spät von dem Angebot. „Die Politik muss mehr auf Staatsanwälte, Richter und Polizei einwirken, dass die die Opfer über uns aufklären“, sagt Lorenz. Bei der Polizei komme der Appell langsam an, 20 Prozent der Opfer kommen durch einen Hinweis von der Polizei zu Lorenz und Zipser. Doch das reicht nicht. „Richter denken oft, emotional aufgewühlte Zeugen seien unbrauchbar. Aber diese Menschen haben Schlimmes erlebt. Hier können wir helfen“, sagt Zipser. So wie im Fall der alten Dame. Nach dem Gespräch mit Lorenz traute sie sich schließlich doch, Hilfe bei ihrem Sohn zu suchen. Und einen Anwalt zu beauftragen, der sich um die Versicherung kümmert. Die Frau hatte Glück, ihr wurden die 15.000 Euro erstattet.