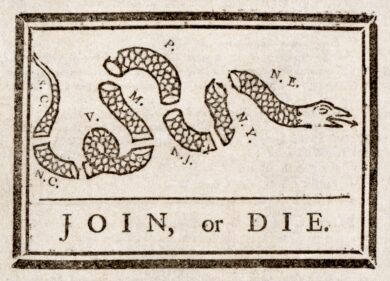Kommentar: Wechselnde Mehrheiten sind Ausdruck einer fehlenden Vertrauensbasis
In diesem Jahr stehen viele Wahlen an – und vermutlich werden in einigen Bundesländern Landtage gebildet, in denen recht viele Gruppierungen sitzen. Wenn diese Schwierigkeiten haben, für eine tragfähige Regierung sichere Koalitionen zu bilden, könnte eine gewählte Regierung ja versuchen, mit wechselnden Mehrheiten im Parlament die nötigen Gesetze und den Haushaltsplan zu verabschieden. Ist das ein zukunftsweisender Weg? Die Rundblick-Redaktion hat dazu unterschiedliche Auffassungen.
CONTRA: Die Lobpreisung von „wechselnden Mehrheiten“ ist häufig genug unredlich – denn sie ist oft nicht mehr als das Eingeständnis einer fehlenden Vertrauensbasis für eine Regierungsbildung. Die Parteien im Parlament sollten besser und intensiver verhandeln, denn sie sind zu einer Verständigung verdonnert, meint Klaus Wallbaum.
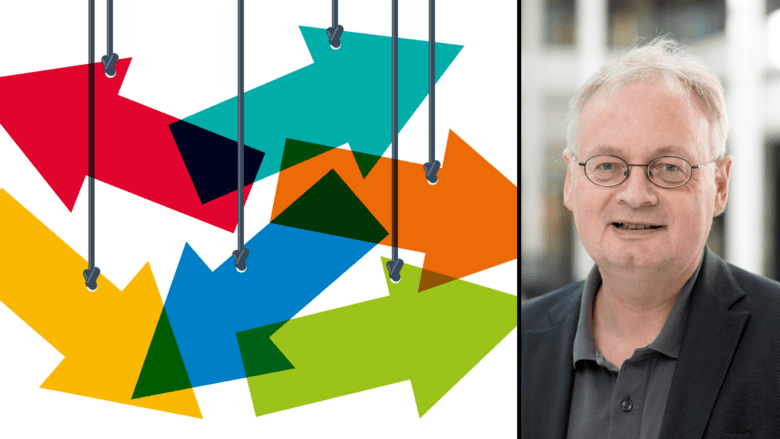
Das politische Geschäft besteht aus einem Geben und Nehmen – und aus einer notwendigen Verlässlichkeit. Unterschiedliche Parteien können unter dieser Voraussetzung in einer Regierung gut zusammenarbeiten, obwohl sie politische Konkurrenten sind. Sie müssen sich nur gegenseitig vertrauen können, einmal gegebene Zusagen müssen eingehalten werden. Man muss auch Umgangsformen finden für plötzliche Krisen und Herausforderungen. Zwar wird es nie gelingen, hunderte von Personen in den Fraktionen auf einen Kurs einzuschwören oder sie zum Wohlverhalten gegenüber dem Koalitionspartner zu zwingen. Wichtig ist es aber, dass die führenden Leute einen guten Draht zueinander haben – und diese dann im Notfall dämpfend einwirken können.
Was aber ist, wenn eine solche Koalitionsbildung einfach nicht klappen will – oder, wie derzeit in der Bundesregierung zu beobachten, wenn einige Partner trotz bester Bemühungen einfach nicht zueinander passen wollen? Eine immer wieder gern geäußerte Empfehlung lautet, dann eben zu den „wechselnden Mehrheiten“ überzugehen: Die SPD beschließt das Polizeigesetz mit der CDU, denn die Grünen würden das nicht mittragen können aus Rücksichtnahme gegenüber den mächtigen Polizei-Kritikern in den eigenen Reihen. Einen Monat später dann beschließt die SPD das Klimagesetz mit den Grünen, da die CDU die Einschnitte gegenüber ihrem starken Bauern-Flügel nie durchsetzen könnte. Am Ende können alle drei mit den Ergebnissen gut leben.
Oder ein anderes Beispiel: Da die CDU in Sachsen eine Koalition mit der Linkspartei definitiv ausgeschlossen hat und auf keinen Fall mit der AfD kooperieren will, wird eine CDU-Minderheitsregierung gebildet, die sich dann auf die Linkspartei stützt. Offiziell wird das Modell der „wechselnden Mehrheiten“ propagiert, obwohl doch klar ist, dass sich die CDU möglichst nie auf Stimmen der AfD stützen will. Aber um das Prinzip zu wahren, bloß nicht mit der Linkspartei koalieren zu wollen, braucht man den Schein der „wechselnden Mehrheiten“. Das hatten wir schon einmal, nämlich vor 30 Jahren bei der Bildung der rot-grünen Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt. Dort pries der damalige Ministerpräsident Reinhard Höppner (SPD) die „wechselnden Mehrheiten“ als „neues Politikmodell“ und „Offenheit des parlamentarischen Prozesses“ an – dabei war es nichts weiter als die Verschleierung einer heimlichen Kooperation mit der PDS, die seinerzeit offiziell von der Bundes-SPD noch vehement abgelehnt worden war. Dieses Höppner-Modell war eine reine Show-Nummer. Für die, die daran glaubten, grenzte es an Selbstbetrug.
Mehrere Gründe sprechen gegen diese „wechselnden Mehrheiten“:
Absprachen beruhen auf Planbarkeit: Regierungsarbeit fußt auf strategischen Konzepten, auf einer Planung von Vorhaben. So ist eine Koalition zu Kompromissen gezwungen, und das kann auch heißen, dass die eine Seite beim Polizeigesetz nachgibt und die andere beim Klimaschutz. In jedem Fall sind verlässliche Absprachen die Bedingung. Sie können bei spontanen Ereignissen kurzfristig geändert werden, beruhen aber im Wesentlichen auf einer Planung. Wo Koalitionen nicht funktionieren und es Dauerstreit gibt, ist das oft Ausdruck einer mangelhaften Koalitionsbildung und fehlenden gegenseitigen Verlässlichkeit. Das liegt dann nicht an der Unterschiedlichkeit der Koalitionsparteien, sondern an der Tatsache, dass sie alle nicht gründlich und offen genug verhandelt haben – oder in die Regierung „hineingestolpert“ sind.
Die Mehrheit braucht die Minderheit: Eine gute parlamentarische Arbeit kann nur aus dem Gegensatz von Regierungsmehrheit und Opposition erwachsen. Stützt sich aber eine Minderheitsregierung auf alle Kräfte im Parlament – mal auf die einen, dann wieder auf die anderen -, so verwischen die Rollen und die wirksame Kontrolltätigkeit der Opposition wird geschwächt. Die Minderheit wird so in die Mitverantwortung gezogen. Oder aber das Gegenteil passiert: Alle Kräfte lehnen, wenn es schwierig wird, die Mitverantwortung für die Regierung ab – und entziehen der Regierung damit schleichend die Vertrauensbasis im Parlament. Eine derartige Unübersichtlichkeit kann parlamentarisches Chaos und chronische Regierungsschwäche erzeugen, klare Linien und Verantwortlichkeiten gehen verloren. Der Mut der Regierenden ebenfalls.
Wechselnde Mehrheiten stoßen an Etatgrenzen: Viele Gesetze sind mit Kosten verbunden, und die Kunst einer guten Haushaltsplanung besteht in Kompromissen. Viele Ausgabenwünsche bleiben unerfüllt, Ansprüche werden gestutzt oder vertagt. Damit ist die Gefahr groß, dass die für den Haushaltsplan nötige Mehrheit nur jene Gesetze mit ausreichend Geld bedient, die auch von dieser Mehrheit beschlossen worden sind – während andere Gesetzesvorhaben dann bei der finanziellen Unterlegung leer ausgehen. Das kann zu Frust führen und neue Konfrontationen aufbauen. Damit wäre dann der schöne Schein der „wechselnden Mehrheiten“, in dem sich alle Parteien im Parlament aufgeschlossen, freundlich und vorurteilsfrei der Sacharbeit widmen, im Handumdrehen vorbei.
Aus diesen Gründen nun ein Ratschlag an alle – seien es die Landtage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, oder auch der Rat der Stadt Hannover: Lieber sollte man mehr Mühe in eine gute Koalitionsbildung stecken statt sich in die gefährliche Vision eines „neuen Politikmodells“ zu flüchten. Das heißt dann aber auch: CDU und Linkspartei müssen in Erfurt, Dresden oder Potsdam zueinanderfinden. Denn niemand dürfte ernsthaft der Meinung sein, die AfD in Thüringen, Sachsen oder Brandenburg wäre für die CDU ein möglicher Koalitionspartner.
Dieser Artikel erschien am 24.01.2024 in der Ausgabe #013.