Corona-Aufarbeitung (4): Die schlimmen Folgen der Schulschließungen wirken nach
Die Corona-Pandemie gilt als überwunden. Doch diese Phase mit ihren Unsicherheiten und ihren strengen Schutzmaßnahmen hat Wunden hinterlassen. Menschen wurden persönlich verletzt, ganze Bevölkerungsteile stehen einander noch immer unversöhnlich gegenüber. Eine Aufarbeitung konnte aber angesichts der neuen Krisen bislang nicht vorgenommen werden. Was kann helfen? Ein Blick auf das Narbengewebe, das sich auf der Seele der Gesellschaft gebildet hat. Heute: die Auswirkungen auf die Kinder.
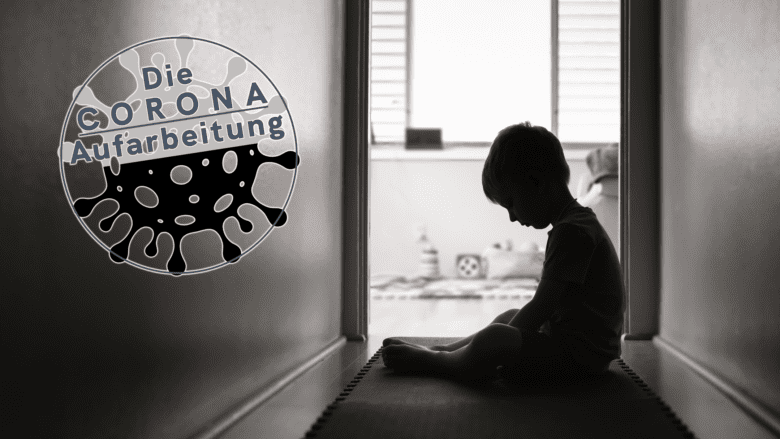
In seiner Phantasie kann der Junge alles: Er springt vom Dach und geht durchs Feuer, ohne einen Schaden zu nehmen. „Er spielt, dass er allmächtig ist“, erklärt Renate Engelhardt-Tups, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Ambulanzleiterin des Winnicotts-Instituts in Hannover. Hier werden Therapeuten ausgebildet, Kinder und Jugendliche behandelt und Eltern beraten. Der Bedarf ist viel größer als die Kapazitäten. „Wir müssen ständig die Warteliste schließen“, sagt Engelhardt-Tups. Sie versuchen, die Familien an niedergelassene Therapeuten zu verweisen, doch auch dort sind die Plätze rar. Ängste, Depressivität, Wutausbrüche: „Alles, was vor Corona schon da war, hat sich drastisch verschlimmert“, beobachtet die Psychoanalytikerin. „Ich kenne nur wenige Eltern, die ihren Kindern in der Pandemie den emotionalen Halt in dem Maße geben konnten, wie es notwendig gewesen wäre.“
Kinder mussten erleben, dass alle Entscheidungen von außen diktiert wurden. Ihre Eltern, die sonst die Regeln machen oder wenigstens erklären können, waren genauso verunsichert, machtlos und überfordert wie sie. „Heute sind sich die Fachleute einig, dass es nie wieder Schulschließungen geben darf“, sagt Engelhardt-Tups. Ab März 2020 mussten alle Schüler zu Hause bleiben. Niedersachsen gehörte zu den letzten Bundesländern, die die Schulen schrittweise wieder geöffnet haben. Am 15. Juni 2020 durften die letzten Kinder zurückkehren. In allen Bundesländern genossen die Abschlussjahrgänge Priorität, die jüngeren Kinder mussten zurückstecken.

Die Volkswirtin Christina Felfe hat die Schulschließungen in den einzelnen Bundesländern in Beziehung gesetzt zu den Daten der Corona-und-Psyche-Studie (Copsy) über Depressivität, psychosomatische Beschwerden, sozio-emotionale und Verhaltensschwierigkeiten. Ihr Fazit in der von der Volkswagenstiftung geförderten Studie: „Die bundesweite Verschlechterung kann vollständig durch die Schulschließungen erklärt werden. Die Familien wurden weitgehend mit der beispiellosen Situation zu Hause alleingelassen, einschließlich der Mehrfachbelastung, Arbeit, Schule und Familienleben unter einen Hut zu bringen.“
Besonders fatal für Kinder, meint die Psychotherapeutin Engelhardt-Tups, wirkte sich das Kontaktverbot zu den Großeltern aus: „Sie sind oft die Bezugspersonen mit der sichersten Ausstrahlung.“ Damals wurde argumentiert, dass die Kinder Opa und Oma anstecken könnten. Angst und Schuldgefühle begleiteten vielfach die Beziehungen in der Familie. Eine, die damals protestiert hat, ist Sina Denecke. Bekannt wurde sie als Sprecherin der Gruppe „Familie in der Krise“ in Niedersachsen. Sie machte den Schock der Eltern öffentlich, denen ein Schreiben des Gesundheitsamtes der Region Hannover ins Haus flatterte. Darin wurde ihnen untersagt, ihre möglicherweise infizierten Kinder in den Arm zu nehmen, sie ins Bett zu bringen oder gemeinsam mit ihnen zu essen. Bei Verstößen wurde sogar mit einer Inobhutnahme durch staatliche Einrichtungen gedroht. Nach dem Protest der Gruppe entschärfte die Region Hannover das Schreiben.
Auch gegen die Schulschließungen hatte „Familie in der Krise“ gewichtige Argumente. „Die Datenlage war schnell klar. Aus China wusste man bereits, dass Kinder nicht so stark von dem Virus betroffen sind“, erinnert sich Denecke. Der Wind, der ihr daraufhin entgegenwehte, traf sie mit voller Wucht. Zu der Zeit setzte die politische Kommunikation darauf, die Risiken möglichst drastisch auszumalen, um Akzeptanz für die Maßnahmen zu erreichen. Die gesellschaftliche Stimmung war stets am Rand der Eskalation. „Wir wurden so beschimpft und in die Schublade der Querdenker gesteckt“, erzählt Denecke. Journalisten sprachen nicht mehr mit ihr. Sogar die Verleihung eines Ehrenamtspreises an eine Mitstreiterin in Baden-Württemberg wurde kurzfristig abgesagt.
Dass Corona stereotype Geschlechterrollen verstärkt hat, ist schon häufig festgestellt worden. Selbst für Kinder kann Renate Engelhardt-Tups das bestätigen: „Jungen sind lauter, renitenter, aggressiver geworden.“ Sie kämpfen gegen das Gefühl der Ohnmacht, das sie durch die Corona-Jahre begleitet hat, und nutzen alle Freiheiten, die sie zurückbekommen haben – oft über ein gesundes Maß hinaus. Viele Mädchen dagegen reagieren eher mit Rückzug und körperlichen Beschwerden. Sie sind schüchtern, depressiv, voller Sorgen und Ängste. Das fällt auch bei den Jugendverbänden auf. „Wir bieten Schulungen dazu an, wie junge Menschen auf Depressionen, Essstörungen oder selbstverletzendes Verhalten reagieren können. Diese Schulungen sind extrem gut besucht“, erzählt Märthe Stamer, Geschäftsführerin des Landesjugendrings. Veranstaltungen und Freizeiten sind schnell ausgebucht. Bei den Kindern ist das Interesse groß, Versäumtes nachzuholen. Doch es fehlt an Teamern, die diese Erlebnisse möglich machen. „Uns ist eine ganze Kohorte weggebrochen“, sagt Rebekka Reinhold, Referentin beim Landesjugendring. Eine Generation fehlt, die sonst vor ein paar Jahren als Teilnehmer in die Jugendarbeit eingestiegen und heute als Gruppenleitung aktiv wären.

Vor einer Weile war Märthe Stamer bei einer Demonstration in Berlin gegen Kürzungen beim Kinder- und Jugendplan des Bundes. Da hat sie die Wut der Teilnehmer gespürt. „Die Jugendlichen sind extrem sauer über den Paternalismus, mit dem die Sparmaßnahmen von heute gerechtfertigt werden mit den Interessen folgender Generationen“, erklärt sie. Denn diese Generation hat schon auf eine Menge verzichtet. Rebekka Reinhold ergänzt: „Jugendliche sind nicht nur Schülerinnen und Schüler. Sie wollen nicht darauf reduziert werden.“ Regina Gehlisch, Vorstandssprecherin des Landesjugendrings, fasst zusammen: „Die Krisen, denen wir aktuell gegenüberstehen, haben einmal mehr deutlich gemacht, dass Jugendarbeit jungen Menschen Perspektiven und Chancen bietet und so ein Teil der kritischen Infrastruktur ist.“
„Wenn man nicht darüber spricht, was in der Pandemie schiefgelaufen ist, dann lernt man nichts daraus“, meint Sina Denecke. Eine Lehre wäre für sie, die Gremien, die im Krisenfall die Entscheidungsträger beraten, diverser aufzustellen. „Damals wurde alles rein virologisch-medizinisch betrachtet. Aber für die Demokratie wäre es besser, auch anderen Gruppen der Gesellschaft zuzuhören.“ Die Initiative Familien e.V., in der die „Familien in der Krise“ mittlerweile aufgegangen sind, fordert einen „Kindervorbehalt“ für künftige Gesetzesvorhaben und Entscheidungen. Damit müssten alle politischen Schritte vor der Umsetzung darauf geprüft werden, welche Auswirkungen sie auf Kinder und Jugendliche haben. Eine Aufarbeitung, meint die Psychotherapeutin Renate Engelhardt-Tups, könnte damit beginnen, sich trotz all der aktuellen Krisen an die Corona-Jahre zu erinnern und offen zu sagen: „Ich habe darunter gelitten.“ Sie könnte auch mit einem Bekenntnis der Politik beginnen: „Wir haben euch ganz schön viel zugemutet.“ Oder damit, Verständnis für diejenigen zu entwickeln, die man damals vehement verurteilt hat. Es könnte in jeder Einrichtung, jedem Team, jedem Freundeskreis beginnen. Vielleicht ist dann so etwas wie ein Heilungsprozess möglich.
Dieser Artikel erschien am 30.11.2023 in der Ausgabe #209.
Karrieren, Krisen & Kontroversen
Meilensteine der niedersächsischen Landespolitik
Jetzt vorbestellen







